Das
Hauptkennzeichen des globalisierten Kapitalismus
seit Anfang der 1980er Jahre ist der sinkende
Lohnanteil, mit anderen Worten der sinkende
Anteil des Bruttoinlandsprodukts (BIP), den
die Lohnabhängigen erhalten. Dieser Tendenz
entspricht, in marxistischen Begriffen gesprochen,
ein Anstieg der Ausbeutungsrate. Es handelt
es sich um ein statistisch eindeutig belegbares
Ergebnis, das für die meisten Länder
des Nordens wie des Südens gilt.
STATISTISCH
UNWIDERLEGBARE DATEN
Die
von offiziellen Körperschaften erstellten
Daten zeigen eine Gesamtentwicklung, die für
alle Industriestaaten, die Europäische
Union und Frankreich gilt. Ungeachtet aller
Polemiken, die sich daran entzündet haben
(siehe Kasten 1) handelt es sich um eine sowohl
vom IWF als auch von der Europäischen Kommission
anerkannte Tatsache. Ein kürzlich von der
Bank für Internationalen Zahlungsausgleich
veröffentlichtes Dokument (Ellis Smith
2007) bestätigt, dass der tendenzielle
Anstieg des Profitanteils (The global upward
trend in the profit share) ein strukturelles
Phänomen ist, das sich nicht auf konjunkturelle
Fluktuationen zurückführen lässt.
Die zeitliche Entwicklung verläuft in allen
Fällen ähnlich: Bis zur Krise Mitte
der 70er Jahre ist der Lohnanteil nahezu stabil,
danach steigt er abrupt an. In der ersten Hälfte
der 80er Jahre kehrt sich der Trend um: Der
Lohnanteil sinkt und pendelt sich tendenziell
auf einem historisch sehr tiefen Niveau ein.
Frankreich
bildet keine Ausnahme, wie die nachfolgende
Tabelle zeigt. Den jüngsten Daten des nationalen
Statistikbüros Insee zufolge liegt der
Anteil der Löhne am Unternehmensgewinn
2006 bei 65,8 %, gegenüber 74,2 % im Jahr
1982, was einem Rückgang von 8,4 Prozentpunkten
entspricht. Gemäß Europäischer
Kommission sank der Anteil der Löhne in
der gesamten EU zwischen 1982 und 2006 um 9,3
Prozentpunkte von 66,5 % auf 57,2 %. Ein analoger
Rückgang lässt sich in allen EULändern
beobachten (8,6 Prozentpunkte). Weniger ausgeprägt
scheint der Rückgang dagegen für die
Gesamtheit der G7 zu sein, was insbesondere
auf die Vereinigten Staaten zurückzuführen
ist. Dieselbe Tendenz findet schließlich
auch in aufstrebenden Ländern wie China,
Mexiko und Thailand statt (Tabelle 1).
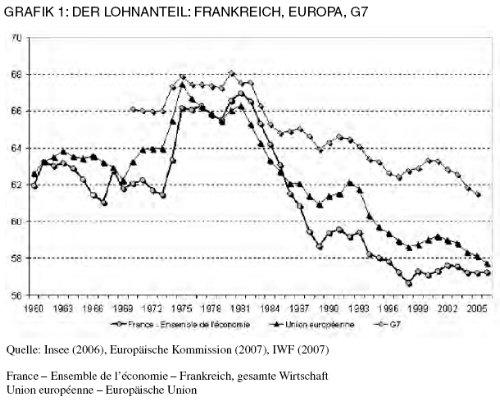
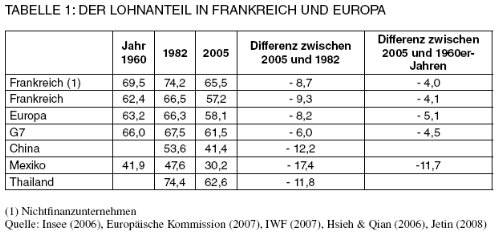
DER
FALL DER VEREINIGTEN STAATEN
Die
wichtigste Ausnahme in dieser Tendenz sind die
Vereinigten Staaten und Großbritannien,
wo der Lohnanteil langfristig im Wesentlichen
unverändert geblieben ist. Diese Feststellung
steht scheinbar in Widerspruch zur Darstellung,
wonach diese beiden Länder führend
in der neoliberalen Politik sind. So fallen
die durchschnittlichen Lohnsteigerungen in Großbritannien
höher aus als in Europa oder Frankreich.
Am deutlichsten sieht man aber an den Vereinigten
Staaten, wie die Dinge liegen. Dass in diesem
Land die Lohnanteile so hoch geblieben sind,
stellt insofern ein wirkliches Paradox dar,
als die Kaufkraft der Bevölkerungsmehrheit
nicht gestiegen ist oder zumindest wesentlich
weniger als die Arbeitsproduktivität. Unter
diesen Bedingungen sollte der Lohnanteil eigentlich
schneller sinken als die zwischen 1980 und 2005
beobachteten 3,5 Prozentpunkte.
Das
Rätsel wurde von den beiden Ökonomen
Ian DewBecker und Robert Gordon gelüftet,
die der Frage nachgegangen sind, wohin die Produktivität
geht. Ihre Antwort ist simpel: Die Produktivitätsgewinne
wurden größtenteils von einer dünnen
Schicht an Nutznießern mit sehr hohen
Löhnen aufgesogen. Deren Löhne sind
derart hoch, dass sie als Aneignung des Profits
betrachtet werden müssen, selbst wenn es
sich formell noch um Löhne handelt. Hier
werden also Kapitaleinkommen wie die berühmten
stock options beiseite gelassen. Dieses Phänomen
könnte als nebensächlich betrachtet
werden, doch es nimmt in Wirklichkeit erhebliche
Ausmaße an. So ist beispielsweise der
Anteil, den das oberste Prozent der Bestverdienenden
erhält, zwischen 1980 und 2005 von 4,4
% auf 8 % gestiegen. Das entspricht einer Aneignung
von 3,6 Prozent des BIP. Für fünf
Prozent der Bestverdienenden liegt der Anteil
bei 5,3 Prozent. Zieht man diese sehr hohen
Löhne ab, erhält man ein vergleichbares
Ergebnis wie in der Europäischen Union
(Grafik 2).
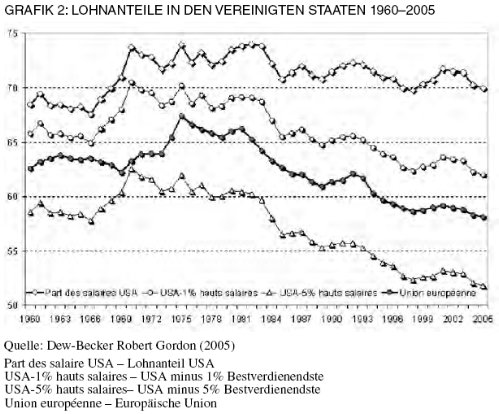
STREIT
UM STATISTISCHE DATEN
Die Feststellung
dieses Trends hat insbesondere in Frankreich
Diskussionen und Kontroversen ausgelöst.
Sie wird im Namen statistischer Spitzfindigkeiten
angezweifelt, die hier rasch genauer
untersucht werden sollen. Tatsächlich
stellen sich bei der Erfassung des Lohnanteils
vor allem zwei sich teilweise überschneidende
Probleme: Erstens muss man entscheiden,
ob man die Gesamtwirtschaft oder nur
Nichtfinanzunternehmen in Betracht ziehen
möchte, zu denen je nachdem Einzelfirmen
im Nichtfinanzbereich hinzugezählt
werden können. Zudem muss der Grad
an Lohnarbeit, mit anderen Worten der
Anteil von Lohnabhängigen an der
Gesamtbeschäftigung, berücksichtigt
werden. Wenn Selbständige im Lauf
der Zeit durch Lohnabhängige ersetzt
werden, wie dies in den meisten Ländern
der Fall ist, steigt der Anteil der
Löhne am Nationaleinkommen, ohne
dass dies einer Verbesserung der relativen
Situation der Einzelnen entspricht.
Um mögliche Vergleiche zwischen
verschiedenen Phasen und Ländern
anstellen zu können, wird in europäischen
Statistiken ein bereinigter Lohnanteil
berechnet, bei dem den nicht lohnabhängigen
Beschäftigten ein Lohn zugeordnet
wird, der dem Durchschnittslohn entspricht.
Damit wird der Durchschnittslohn mit
dem BIP pro Beschäftigten verglichen.
Die maßgeblichen Indikatoren sind
also der Lohnanteil am gesellschaftlichen
Mehrprodukt von Nichtfinanzunternehmen
und der bereinigte Lohnanteil für
die Gesamtwirtschaft. Der im Bereich
von Nichtfinanzunternehmen berechnete
Lohnanteil ist tatsächlich jener
Anteil, für den die Begriffe der
Lohnmasse und des Unternehmensmehrprodukts
am treffendsten definiert sind. Die
Probleme mit Einzelfirmen und selbständig
Beschäftigten entfallen ebenso
wie die Schwierigkeit, das Mehrprodukt
im Versicherungs, Bankenund Staatssektor
(Staat, Sozialversicherungen, Gemeinden)
zu bestimmen. Der bereinigte Lohnanteil
bietet den Vorteil, dass er das Problem
der selbständig Beschäftigten
berücksichtigt und annähernd
vertrauenswürdige internationale
Vergleiche zulässt.
|
GRÜNDE
FÜR DIE TRENDUMKEHR
Für
die Neoliberalen stellt diese Trendumkehr weitgehend
ein Rätsel dar. In einem Interview für
die Financial Times (Guha 2007) bemerkt Alan
Greenspan, der ehemalige Präsident der
USZentralbank, ebenfalls dieses „äußerst
seltsame Kennzeichen“ des heutigen Kapitalismus:
„Der Anteil der Löhne am Nationaleinkommen
in den Vereinigten Staaten und anderen Industriestaaten
hat einen im historischen Vergleich ausgesprochen
tiefen Stand erreicht.“ Langfristig „tendiert
der Reallohn dazu, parallel zur realen Produktivität
zu steigen“. Das sei „über
Generationen“ beobachtet gewesen, heute
aber nicht mehr der Fall. Der Reallohn habe
„abzuweichen“ begonnen aus Gründen,
die nach Ansicht Greenspans nicht klar sind.
Dieser „erwartet seit langem und noch
immer“ eine Normalisierung der Verteilung
zwischen Löhnen und Profiten und befürchtet
gleichzeitig „den Verlust politischer
Unterstützung für die freien Märkte,
wenn die Durchschnittslöhne der amerikanischen
Arbeiter nicht demnächst schneller wieder
ansteigen.“
Dennoch
wird in zahlreichen Texten versucht, sich mit
dieser Tendenz zum Fall des Lohnanteils auseinanderzusetzen.
Dafür werden zahlreiche Erklärungen
bemüht: der Energiepreis, die Zinsrate,
die höhere Kapitalintensität. Diese
Erklärungen halten aber nicht stand:
- Nicht
alle Länder waren gleich betroffen von
den Energiepreissteigerungen und der Erdölgegenschock
1986 brachte keine Trendumkehr;
- Die
Trendumkehr zu sinkenden Lohnanteilen fiel
zwar mit der Explosion der Zinsraten zusammen
und drückte tatsächlich auf die
Löhne, doch dieser Faktor kann die langfristige
Entwicklung nicht erklären und hätte
seine Wirkung einbüßen müssen,
als die Zinsraten wieder zu sinken begannen.
- Das
Sinken des Lohnanteils kann auch nicht durch
im Verhältnis zur Arbeit höhere
Kapitalinvestitionen erklärt werden,
denn die Investitionsrate ist nicht gestiegen
und ein zunehmender Anteil der Profite fließt
in Finanzeinkommen.
Gemeinsam
ist den Erklärungsversuchen, dass eine
strikt wirtschaftliche Erklärung für
ein zutiefst soziales Phänomen gesucht
wird. Die allgemeine Entwicklung des Lohnanteils
lässt sich wesentlich einfacher durch das
Kräfteverhältnis zwischen den gesellschaftlichen
Klassen erklären. Während der Jahre
des Wirtschaftsaufschwungs vom Ende des Zweiten
Weltkriegs bis zur Krise Mitte der Siebzigerjahre
war dieses relativ ausgeglichen, um dann plötzlich
aus dem Gleichgewicht zu geraten.
Zuerst
führte die Krise zu einer Steigerung des
Lohnanteils, da das Lohnwachstum noch anhielt,
während die Arbeitsproduktivität plötzlich
einbrach. Die klassische Politik der Wirtschaftsankurbelung
funktionierte nicht mehr, und die herrschenden
Klassen verlegten sich daraufhin auf eine neue
Strategie: Sie gaben die „keynesianische“
Politik auf und orientierten sich voll auf einen
neoliberalen Kurs. Alle Hebel wurden in Bewegung
gesetzt, insbesondere der Schock der Steigerung
der Zinsraten und die Globalisierung, doch das
wesentliche Werkzeug war die krisenbedingte
steigende Arbeitslosigkeit. Die kapitalistische
Führungselite stützte sich auf dieses
Phänomen, um die Regeln der Lohnbildung
grundlegend und brutal umzustoßen. Von
einer Lohnnorm, in der die Löhne gleichzeitig
mit der Produktivität stiegen, so dass
der Lohnanteil nahezu konstant blieb, ging man
zu einer neuen Regelung über, in der die
Löhne schwächer stiegen als die Produktivität,
die gegenüber den Wachstumsjahren selbst
schwächer wuchs. Unter diesen Bedingungen
flossen die Produktivitätsgewinne nicht
mehr an die Lohnabhängigen, deren Kaufkraft
blockiert wurde, sondern in die Profite; von
da an sank der Lohnanteil.
Mit
einer einfachen ökonometrischen Modellrechnung
kann diese Interpretation gestützt werden
(siehe Anhang 1 und 2). Sie zeigt, dass die
Arbeitslosenrate eine entscheidende Rolle spielt
und die vorherrschende Theorie von einer ausgeglichenen
Arbeitslosenquote (Gleich-gewichtsarbeitslosigkeit)
dieses Verhältnis zwischen Arbeitslosigkeit
und Einkommensverteilung nur implizit abbildet.
ARBEITSLOSIGKEIT
UND FINANZIALISIERUNG
Das
Sinken des Lohnanteils führte zu einer
spektakulären Wiederherstellung der durchschnittlichen
Profitraten ab Mitte der 1980er Jahre. Gleichzeitig
fluktuierte weiterhin die Akkumulationsrate
auf niedrigerem Niveau als vor der Krise (Grafik
3). Mit anderen Worten wurde der Aderlass bei
den Löhnen nicht genutzt, um mehr zu investieren.
Der berühmte Ausspruch Schmidts, wonach
„die Profite von heute die Investitionen
von morgen und die Arbeitsplätze von übermorgen“
seien, hat nicht funktioniert. Der nicht investierte
Profit wurde hauptsächlich in Form von
Finanzprofiten verteilt. Die Kluft zwischen
den von den Unternehmen herausgeschlagenen Profiten
und jenem Anteil dieser Profite, der in Investitionen
floss, ist daher ein guter Indikator für
den Grad an Finanzialisierung, also dem Gewicht
des Finanzsektors. Dabei lässt sich zeigen,
dass sich die Arbeitslosigkeit parallel zur
Finanzialisierung entwickelt (Grafik 4). Auch
hierfür gibt es einen einfachen Grund:
Die Finanzwelt konnte sich den Großteil
der Produktivitätsgewinne auf Kosten der
Löhne aneignen, deren Anteil sank.
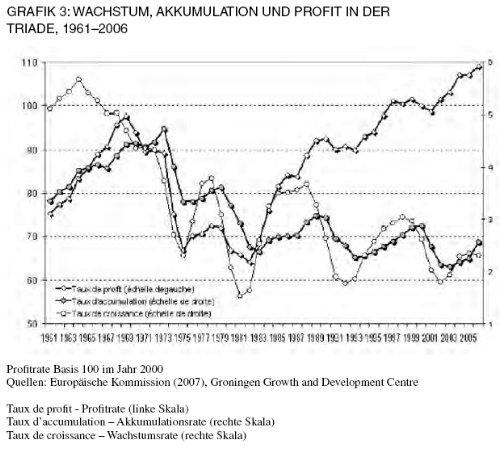

Der
beobachtete Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit
und Finanzialisierung kann die Interpretation
des modernen Kapitalismus als finanzmarktlastig
allerdings nicht rechtfertigen. Das Verhältnis
zwischen Industrieund Finanzkapital hat sich
zweifellos grundlegend verändert und lastet
auf den Ausbeutungsbedingungen. Allerdings muss
ein richtiger Zusammenhang zwischen den verschiedenen
Phänomenen hergestellt werden. Man kann
nicht eine autonome Tendenz zur Finanzialisierung
behaupten, die losgelöst wäre vom
normalen Funktionieren des „guten“
Industriekapitalismus. Damit würde man
künstlich die Rolle des Finanzsektors loslösen
vom Klassenkampf um die Aufteilung des gesellschaftlichen
Mehrprodukts. Sobald die Profitrate dank Rückgangs
der Löhne steigt, ohne rentable Akkumulationsmöglichkeiten
zu schaffen, beginnt die Finanzwelt eine funktionelle
Rolle in der Reproduktion zu spielen, indem
sie Absatzalternativen zur kaufkräftigen
Nachfrage seitens der Lohnempfänger bietet.
Diese
Meinung, die ich seit langem vertrete (Husson
1997, 2006), wird durch die Berücksichtigung
der Globalisierung bekräftigt. Unter diesem
Gesichtspunkt ist die Hauptfunktion der Finanzwelt,
so gut wie möglich die Schranken zwischen
verschiedenen Verwertungsmöglichkeiten
abzubauen. Sie trägt in diesem Sinn zur
Entstehung eines Weltmarkts bei. Die große
Stärke des Finanzkapitals besteht in Wirklichkeit
darin, sich über geografische und Sektorgrenzen
hinwegzusetzen, weil es sich die Mittel verschafft
hat, sehr rasch von einer Wirtschaftszone auf
die andere, von einem Sektor auf den anderen
umzusatteln. Kapitalbewegungen finden unterdessen
in wesentlich bedeutenderen Größenordnungen
statt. Die Funktion der Finanzmärkte besteht
hier darin, die Gesetze der Konkurrenz zu verschärfen,
indem Kapitalverlagerungen verflüssigt
werden. In Abwandlung einer Aussage von Marx
zur Arbeit könnte man sagen, dass die globalisierte
Finanz jener konkrete Abstraktionsprozess ist,
der jedes individuelle Kapital einem Wertgesetz
unterwirft, dessen Anwendungsbereich sich unablässig
erweitert. Die Hauptcharakteristik des gegenwärtigen
Kapitalismus besteht also nicht im Gegensatz
zwischen Finanzund Industriekapital, sondern
in einer aufgrund der Finanzialisierung extremen
Konkurrenz zwischen Kapitalien.
Anhang
1: Ökonometrie der Verteilung
Die
hier dargestellte Modellrechnung geht
davon aus, dass der Grad der Koppelung
des Lohns an die Produktivität
von der Arbeitslosenrate abhängt.
Die Lohnprogression hängt damit
vom Produktivitätswachstum ab.
Doch diese Koppelung lockert sich auf,
wenn die Arbeitslosigkeit steigt. Da
der Lohnanteil selbst von der relativen
Lohnund Produktivitätsentwicklung
abhängt, kann mit dieser Angleichung
indirekt der Einfluss des Kräfteverhältnisses
auf dem Arbeitsmarkt gemessen werden.
Die erhaltene Schätzung für
die gesamte Europäische Union bietet
eine solide Grundlage, die es ermöglicht,
die rückläufige Entwicklung
des realen Lohnwachstums darzustellen.
Dieses
Modell schreibt sich als Lohn = (a +
b x Arbl) x Prod + c mit den Kenngrößen
a,b,c und Lohn = Wachstumsrate des Reallohns
Arbl = Arbeitslosenrate
Prod = Wachstumsrate der Produktivität
Die
Annahmen für die gesamte Europäische
Union für den Zeitraum 1961–2006
führen zu folgender Schätzung:
| Lohn
= |
(1,156
– |
0,159
AL) |
x
Prod |
+
1,371 |
| |
(12,0) |
(6,8) |
|
(4,4)
|
(Bei
einer Arbeitslosigkeit von Arbl=6% und
einem Wachstum von Prod=2% sagt die
Formel eine Lohnsteigerung von Lohn=
(1,156 – 0,159 * 6) * 2 + 1,371
= 1,775 Prozent jährlich voraus.
Die Zahlen in der unteren Zeile sind
die tKoeffizienten der Schätzung;
wenn sie größer als 2 sind,
kann man annehmen, dass der jeweilige
Parameter signifikant ist)

|
Anhang
2:
Gleichgewichtsarbeitslosigkeit
und Verteilung Die vorherrschende Wirtschaftstheorie
zieht das negative Verhältnis zwischen
Arbeitslosigkeit und Lohn heran, um
eine „Gleichgewichtsarbeitslosigkeit“,
kurz Nairu (Non Accelerating Inflation
Rate of Unemployment), zu bestimmen.
Gemeint ist jene Arbeitslosenquote,
ab der die Inflation angekurbelt wird.
Sie errechnet sich durch Kombination
der Lohnund der Preisgleichungen in
einem makroökonomischen Standardmodell.
Die
Lohngleichung besagt, dass das Wachstum
des Nominallohns (w) von drei Elementen
abhängt:
-
einer
Kopplung an die Preissteigerungsrate
(p), hier zu 100% angenommen
-
einem
autonomen [von den anderen Größen
bereinigten] Kaufkraftwachstum
-
einer
Abhängigkeit (Kenngröße
b) von der Arbeitslosenrate (U), die
negativ auf das Lohnwachstum wirkt.
Diese
Lohngleichung lautet also:
(1) w = p + a – bU
Die
Preisgleichung beschreibt die Preisbildung,
indem eine Verdienstspanne auf die Einheitslohnkosten
(den Lohn pro Produkteinheit) angerechnet
wird. Deren Entwicklung hängt von
drei Faktoren ab:
-
dem
Wachstum des Nominallohns (w);
-
dem
Produktivitätswachstum (n);
-
der
Entwicklung (und nicht der Höhe)
der Verdienstspanne (m)
Die
Formel für den Preis lautet folglich:
(2) p = w ? + m
Diese
beiden Gleichungen bilden die so genannte
PreisLohnSpirale.
Die Theoretiker erlauben sich, durch
Kombination der Gleichungen (1) und
(2) die Preise (p,w) zu eliminieren
und berechnen die „Gleichgewichtsarbeitslosigkeit
Nairu“ (U*) wie folgt:
(3) U* = (m + a - n)/ b
Die
Argumentation ist dabei folgende: Sinkt
die Arbeitslosenquote zu stark (unter
den Nairu), steigt der Reallohn tendenziell
schneller als die Produktivität,
und die Unternehmen sind „gezwungen“,
ihre Preise zu erhöhen, um ihre
Gewinnspanne zu halten. Das werden sie
so lange tun, bis es durch die zusätzliche
Inflation gelingt, die Zunahme der Erwerbstätigkeit
abzubremsen, mit anderen Worten einen
Zuwachs an Arbeitslosigkeit zu schaffen,
der die Arbeitslosenquote auf das NairuNiveau
zurückführt. Der Nairu bildet
somit tatsächlich eine „Gleichgewichtsrate“,
insofern es sinnlos wäre zu versuchen,
ihn gegen seine „Rückstellkraft“
zu unterschreiten.
Implizit
wird bei diesen Überlegungen jedoch
eine konstante Gewinnspanne vorausgesetzt,
denn sonst würde eine Lohnerhöhung
nicht automatisch zu einer Preiserhöhung
führen, sondern sich in der Abnahme
der Verdienstspanne ausdrücken.
Die Theorie der Gleichgewichtsarbeitslosigkeit
ist mit anderen Worten auch eine Theorie
der Gleichgewichtsverdienstspanne. Der
Nairu steht auch für eine „Arbeitslosenquote,
die den Lohnanteil nicht erhöht“,
jene Quote, unter der die Einkommensverteilung
durch die Lohnprogression in Frage gestellt
zu werden droht. Man könnte genauso
gut von einer Theorie der „Gleichgewichts-ausbeutungsrate“
sprechen, die umso höher ist, je
höher die Arbeitslosenquote und
die Produktivitätsgewinne sind,
sofern sich Letztere nicht voll auf
die Löhne niederschlagen.
|
Quelle:
http://hussonet.free.fr und Inprecor, Januar
2008.
Die
elektronisch verfügbaren Quellen finden
sich unter folgender Adresse http:// hussonet.free.fr/capur.htm.
Aus dem Französischen: Tigrib |