Anstelle
des 1990 verkündeten »Endes der
Geschichte« erleben wir gegenwärtig
die Renaissance eines zunehmend ungezügelten
Kapitalismus, wie es ihn zuletzt in der Zeit
zwischen den Weltkriegen gab. Mit dem unscharfen
Begriff der »Globalisierung« wird
heute eine Wirtschaftsordnung bezeichnet,
die von einer zunehmenden Konzentration des
Reichtums auf die Zentren (Teil I von Winfried
Wolfs Analyse) und immer häufiger auftretenden
zyklischen Konjunkturkrisen geprägt ist
(Teil II). Der heutige Teil beschäftigt
sich mit den sozialen Folgen dieser Entwicklung:
der wachsenden Kluft zwischen Arm und Reich.
Vorhersagen von Krisen im Kapitalismus sind
kaum möglich. Der Grund ist in den vielfältigen
antagonistischen Widersprüchen zu suchen,
die der kapitalistischen Produktion selbst
zugrunde liegen. Es war weder Karl Marx, noch
wäre es einem modernen Computermodell
möglich, die exakten Wechselwirkungen
dieser Widersprüche zu berechnen. Diese
sind zu komplex – sie schließen
sich einerseits aus, andererseits bedingen
sie einander.
Karl Marx irrte oft in der konkreten Vorhersage
von Krisen, betonte aber, daß dies in
der Natur der Sache liege. In einem Brief
an Friedrich Engels vom 8. Dezember 1857 schrieb
er: »Dear Frederick, (...) da Lupus
(d.i. Wilhelm Wolff) beständig Buch über
unsere Krisenvorhersagen führte, so erzähle
ihm, daß der Economist von letztem Sonnabend
erklärt, die Endmonate von 1853, durch
ganz 1854, Herbst 1855 und ›the sudden
changes of 1856‹ (die plötzlichen
Veränderungen des Jahres 1856, W.W.)
habe Europa immer nur hair breadth escape
vom impending crash (die Rettung um Haaresbreite
vom drohenden Krach) gehabt.« (MEW 29,
S. 225)
So macht es Sinn, sich bei konkreten Krisenvorhersagen
zurückzuhalten. Die Tatsache, daß
sich die Konjunktur in einem Zyklus bewegt
und daß auf jeden Aufschwung ein Abschwung
und – in der aktuellen Phase der kapitalistischen
Produktion – eine Krise mit absolut
rückläufiger Produktion –
folgt, ist jedoch unbestreitbar.
Da das Zugeständnis, daß Krisen
etwas mit dem Kapitalverhältnis selbst
zu tun haben, diese Wirtschaftsweise disqualifiziert,
versuchen bürgerliche Ökonomen,
die Krisenanfälligkeit im Bereich von
Naturgewalten und bei der Meteorologie anzusiedeln.
Am 26. August 1932, auf dem Höhepunkt
der Weltwirtschaftskrise, schrieb der Leiter
des Deutschen Institutes für Konjunkturforschung,
Professor Ernst Wagemann, über den Charakter
der Krise: »Solche von außen her
auf die Wirtschaft einwirkenden Ereignisse
sind ebensowenig wie Erdbeben, Brandkatastrophen
usw. mit den Methoden der Konjunkturforschung
vorauszusehen, auch ihre Folgen entziehen
sich jeder quantitativen Voraussicht.«

Tanz auf den
Trümmern des Sozialstaates: Eröffnung
des Wiener Opernball
Verortung
im neuen Zyklus
Auch wenn eine exakte Vorhersage der nächsten
Krise spekulativ ist, so ist es doch sinnvoll,
den aktuellen Stand im Krisenzyklus zu bestimmen.
Die nebenstehende Tabelle gibt die Wachstumsraten
des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in der Triade
(Nordamerika, Japan und Europa) und in China
an. Da beim BIP alle Einkommen, auch die der
Dienstleistungssektoren, zusammengefaßt
sind, wird die Zyklizität abgeschwächt
wiedergegeben. Im Fall einer Wiedergabe der
industriellen Produktion wären die Ausschläge
nach oben und unten stärker. So sank
in den Krisenjahren 2001 und 2002 in allen
drei imperialistischen Zentren die Produktion
auch absolut. Dennoch erkennt man auch bei
diesen BIP-Zahlen:
– Es gibt einen weitgehend synchronen
Verlauf des Konjunkturzyklus in den zwei imperialistischen
Zentren Nordamerika und Europa. Japan spielt
die bekannte Sonderrolle mit seiner langen
Stagnationsphase 1992 bis 2002.
– Der Aufschwung des vorangegangenen
Zyklus endete 2000 und mündete 2001 und
2002 in zwei Krisenjahre.
– In der BRD und in weiteren Teilen
der Eurozone gab es eine leichte zeitliche
Verschiebung des zyklischen Verlaufs, wie
er von der US-Ökonomie vorgegeben wurde:
Hier waren vor allem 2002 und 2003 die entscheidenden
Krisenjahre.
– 2003 begann in den USA der neue Aufschwung.
Die Eurozone setzte 2004 zu einem Aufschwung
an, der jedoch 2005 bereits wieder abebbte.
– Die chinesische Ökonomie erlebte
in all diesen Jahren keine größeren
Einbrüche des BIP. Allerdings äußerte
sich die internationale Krise in den Jahren
2001 und 2002 auch hier in reduzierten Wachstumsraten.
2005 gab es einen deutlichen Rückgang
des Wachstums in den USA. In der Eurozone
hat sich das Wachstum gegenüber dem Vorjahr
fast halbiert; es liegt mit 1,2 Prozent (BRD:
0,8 Prozent) nahe an der Stagnation. Zum Jahreswechsel
2005/2006 ist der Zyklus bereits durch Elemente
der Überproduktion gekennzeichnet. In
der internationalen Autoindustrie –
der für den weltweiten Zyklus wichtigsten
Branche – gab es 2005 Kapazitäten
zur Fertigung von rund 65 Millionen Autos;
die reale Produktion lag jedoch bei 53 Millionen.
Trotz unausgelasteter Kapazitäten von
gut einem Fünftel wurde vielfach auf
Halde produziert bzw. die zuviel produzierten
Autos können nur durch massive Rabatte
verkauft werden. Da es allerorten –
auch aufgrund der noch niedrigen Zinsen –
zu einer Ausweitung der Kredite kommt, kann
die Nachfrage noch künstlich gesteigert
und verlängert werden. Seit Frühjahr
2005 begann die Fed, die US-Zentralbank, die
Zinsen wieder deutlich anzuheben, im November
2005 folgte die Europäische Zentralbank
(EZB).
Bei einem oberflächlichen Blick könnte
man sagen: Die nächste internationale
Krise wird voraussichtlich 2007 oder 2008
eintreten. Und darüber könnte zwischenzeitlich
unter dem Motto »business as usual«
zur Tagesordnung übergegangen werden.
Beschränkter
Massenkonsum
Nun gibt es jedoch eine Reihe von Faktoren,
die eine besondere Unsicherheit für den
weiteren Gang des Zyklus darstellen und die
eine Krise früher auslösen bzw.
deren Tiefe vergrößern könnten.
Dazu zählen vor allem die Ungleichgewichte
im Weltfinanzsektor. Doch auch ohne diese
Besonderheiten gibt es einen klassischen Widerspruch
innerhalb des kapitalistischen Krisenzyklus,
der die kommende Krise vertiefen muß.
Es handelt sich um den Widerspruch zwischen
der kaum begrenzten Steigerung von Produktivkraft
und Produktion und der beschränkten Massenkaufkraft.
Dieser Widerspruch spielt im modernen, neoliberalen
Kapitalismus eine weit größere
Rolle als in der vorausgegangenen Phase. Er
wurde von Karl Marx in Band III des »Kapital«
als entscheidend für die kapitalistische
Krise bezeichnet und wie folgt charakterisiert:
»Die Bedingungen der unmittelbaren Exploitation
und die ihrer Realisierung sind jedoch nicht
identisch. Sie fallen nicht nur nach Zeit
und Ort, sondern auch begrifflich auseinander.
Die einen sind nur beschränkt durch die
Produktivkraft der Gesellschaft, die anderen
(...) durch die Konsumtionskraft der Gesellschaft.
Dies letztere ist aber bestimmt (...) durch
die Konsumtionskraft auf Basis antagonistischer
Distributionsverhältnisse, welche die
Konsumtion der großen Masse der Gesellschaft
auf ein nur innerhalb mehr oder weniger engen
Grenzen veränderliches Minimum reduziert.«
(MEW 25, S. 254) Mit anderen Worten desselben
Autors: »Es werden zuviel Waren produziert,
um den in ihnen enthaltenen Wert und darin
eingeschlossenen Mehrwert unter den durch
die kapitalistische Produktion gegebenen Verteilungsbedingungen
und Konsumtionsverhältnissen zu realisieren
und in neues Kapital rückverwandeln zu
können.« (a. a. O., S. 268)
In der aktuellen volkswirtschaftlichen Debatte
ist oft die Rede von einer »zu hohen
Sparquote«, von einer »(falschen)
Zurückhaltung der Konsumenten«
aufgrund von »typisch deutscher Zukunftsangst«.
Demgegenüber seien die USA ein wahres
Konsumentenparadies. Auch wirke der Slogan
»Geiz ist geil« – und seine
Folgen – kontraproduktiv. Im Spiegel
war zu lesen: »Während die US-Verbraucher
trotz Terrorhysterie und Rezession shoppen
wie selten zuvor, verweigern sich die Deutschen
einfach. Der Unterschied: Die Amerikaner treibt
ein unerschütterlicher Glaube in die
Geschäfte (...), an Gegenwart und Zukunft
des Landes. Das Vertrauen in die Politik ist
bei den Deutschen nicht besonders ausgeprägt
(...) Nirgendwo ist die ›gefühlte
Lage‹ so schlecht. Und um Gefühle
geht es dauernd (...) Es fehlt an Glauben
in die Wirtschaft und in ihre Elite.«
(Der Spiegel, Nr. 51/2004)
Hiermit werden die Verhältnisse auf den
Kopf gestellt. Nicht das »Sparverhalten«
und nicht der »Geiz« beschränken
den Konsum. Es sind die seit langem stagnierenden
individuellen Einkommen und die rückläufige
Zahl der Erwerbstätigen und der abhängig
Beschäftigten – gepaart mit der
wachsenden Massenerwerbslosigkeit –,
die die privaten Konsumausgaben reduzieren.
Diese Masseneinkommen – und damit die
Nachfrage – stagnieren wiederum, weil
zugleich die Gewinne steigen. Die Armut wächst,
weil parallel die Anhäufung des Reichtums
bis dahin kaum vorstellbare Ausmaße
annahm.
Produktion
von Reich und Arm
Die Nettogewinne der deutschen Kapitalgesellschaften
– nur Aktiengesellschaften und GmbH
– lagen 2004 um 113 Prozent über
dem Niveau von 1991. Die Reallöhne in
der BRD gingen im Zeitraum 1991 bis 2004 zurück
(um rund 3,5 Prozent). Sie liegen heute ungefähr
auf dem Niveau, das Mitte der achtziger Jahre
in Westdeutschland erreicht war. Gleichzeitig
haben sich die Bezüge der Vorstände
der deutschen Aktiengesellschaften allein
im Zeitraum 1997 bis 2003 verdoppelt –
bereits preisbereinigt, also in realen Werten.
Die Lohnquote – der Anteil der Löhne
und Gehälter am gesamten Volkseinkommen
– sank seit 1980 fast kontinuierlich.
Sie lag vor 25 Jahren bei 75 Prozent, war
bis zum Wendejahr 1990 auf 68 Prozent gesunken.
Danach stieg sie bis 1994 leicht an und sank
bis 2003 auf 67 Prozent. Der zitierte Anstieg
der Gewinne im gleichen Zeitraum korreliert
mit dieser Entwicklung.
Selbst der Verweis auf die »zu hohe
Sparquote« ist Unsinn. Die Financial
Times Deutschland (FTD) konstatierte dazu
Mitte 2005: »In den vergangenen Jahren
ist die Sparquote zwar gestiegen, aber vor
allem deshalb, weil sie zuvor im Börsenboom
stark zurückgegangen war. Diese Korrektur
ist jetzt abgeschlossen. Ende 2003 sank (!)
die Sparquote sogar wieder, auf eben jene
10,6 Prozent. Sie liegt jetzt um 0,4 Prozentpunkte
unter – und nicht über –
dem Durchschnitt seit der Wiedervereinigung.«
In den USA ist die reale Entwicklung nicht
völlig entgegengesetzt. 1991 kam es hier
erstmals zu Reallohnverlusten. Danach gab
es bei den realen Einkommen weitgehend Stagnation.
Erst 2001 wurde wieder das Niveau von 1991
erreicht. Im Zeitraum 2001 bis 2004 stiegen
die Reallöhne wieder leicht an. Allerdings
wuchs die Produktivität dreimal schneller.
Doch 2005 gab es erneut einen Reallohnabbau.
Die FTD geht davon aus, daß der Grund
für diese Kluft darin liegt, daß
es »zu einer langfristigen Verschiebung
des Kräfteverhältnisses zwischen
Arbeitnehmern und Arbeitgebern« kam.
So lag der gewerkschaftliche Organisationsgrad
1983 noch bei 20 Prozent. Er liegt inzwischen
bei 12,5 Prozent.
Wenn dennoch immer wieder auf das hohe Wachstum
des Konsums in den USA verwiesen wird, so
gibt es dafür eine Reihe spezifischer
Erklärungen. Dazu zählen das stetige
Wachstum der Bevölkerung und der Zahl
der Erwerbstätigen (in der BRD stagniert
die Bevölkerung; die Zahl der Erwerbstätigen
ist deutlich rückläufig). Es gibt
einen rasanten Anstieg der Immobilienpreise,
was zu Einkommenssteigerungen und zu besseren
Möglichkeiten der Kreditaufnahme führt.
Letzteres wird zusätzlich durch ein US-Zinsniveau
begünstigt, das seit Jahren deutlich
unter demjenigen in der Eurozone liegt.
Ein entscheidender Grund ist auch die unterschiedlich
hohe Kreditaufnahme. In der BRD stiegen die
Konsumentenkredite im Zeitraum 1998 bis 2004
um 35 Prozent, in den USA um 65 Prozent. Das
heißt: Auch in der BRD diente der Anstieg
der Kreditaufnahme zur Überbrückung
der Absatzschwierigeiten. In den USA liegt
das Niveau dieser künstlichen Nachfrage
allerdings nochmals deutlich höher. Inzwischen
übersteigt in den USA die Verschuldung
der privaten Haushalte neun Billionen US-Dollar.
Das bedeutet, daß der Durchschnittshaushalt
mehr Schulden hat, als er im Jahr netto verdient.
In beiden Fällen – USA und BRD
– ist offenkundig, daß diese Art
Nachfrage nicht unendlich fortgesetzt werden
kann. In der BRD waren 1994 zwei Millionen
Haushalte überschuldet. 2004 waren es
3,3 Millionen.
Die obengenannten Einkommensdifferenzen münden
– wesentlich unterstützt von den
gegensätzlichen Eigentumsverhältnissen,
die für Klassengesellschaften charakteristisch
sind – in krassen Prozessen der Reichtumsanhäufung
und der Verbreitung von Armut. In der BRD
hat sich das private Geldvermögen –
ohne Immobilien und Produktivvermögen
– im Zeitraum 1991 bis 2004 mehr als
verdoppelt – von 2020 Milliarden Euro
auf 4076 Milliarden Euro. Die Zahl der Millionäre
– Menschen mit mehr als einer Million
Euro als flüssigem Geldvermögen
auf dem Konto (erneut: ohne Immobilienbesitz)
stieg von 510000 im Jahr 1997 auf 760300 im
Jahr 2004. Wobei im Jahr eins nach Hartz IV
mit großem Bedauern festgestellt wurde,
daß die Zahl der Euromillionäre
2004 »nur« um 4400 anstieg. Dabei
verfügen allein diese neuen 4 400 Euromillionäre
über ein Geldvermögen von 4,4 Milliarden
Euro. Insgesamt entspricht das auf Konten
gehortete Geldvermögen der BRD-Millionäre
von vier Billionen dem Doppelten des Bruttoinlandsproduktes
des Landes.
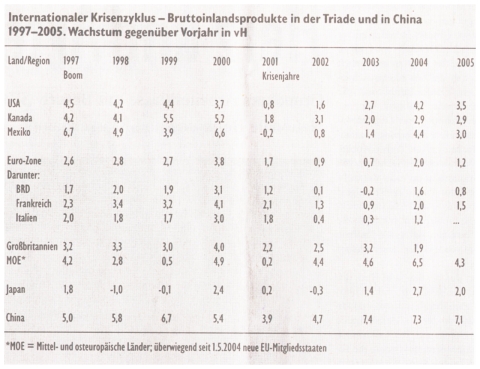
Es handelt sich um einen internationalen Prozeß.
Weltweit wuchs das flüssige Geldvermögen
der Dollarmillionäre auf 30800 Milliarden
US-Dollar im Jahr 2004. Das war allein gegenüber
dem Vorjahr ein Anstieg um 8,2 Prozent. Dieses
Geldvermögen befindet sich in den Händen
von 8,3 Millionen Millionären. Gegenüber
dem Jahr 2003 waren das 600000 Dollar-Millionäre
mehr; einen so großen absoluten Anstieg
hat es nie zuvor gegeben. Das Geldvermögen
dieser Geldelite liegt ziemlich genau auf
der Höhe des Welt-Bruttonationaleinkommens
(wobei das letztere die Summe der jährlichen
Einnahmen ist und das erstere die Anhäufung
von Vermögen darstellt, das über
einen längeren Zeitraum akkumuliert –
aus fremder Arbeit angeeignet – wurde).
Interessanterweise wuchs die Zahl der Dollarmillionäre
am schnellsten in Afrika (2004: + 13,7 Prozent),
in Nordamerika (+ 9,7 Prozent), im Mittleren
Osten (9,5 Prozent) und in der Region Asien/Pazifik
(+ 8,2 Prozent).
Bei der genannten Gesamtzahl von 30800 Milliarden
Dollar flüssigem Geldkapital handelt
es sich nur um jenen Betrag, den die Dollarmillionäre
auf sich konzentrieren. Insgesamt –
die nicht ganz so vermögenden Privaten
und die Unternehmen mitberücksichtigt
– gibt es weltweit ein flüssiges
Geldvermögen von rund 60 Billionen (60000
Milliarden) Euro.
Nun wird die Debatte über Gewinnmaximierung
und Reallohnabbau und über Reich und
Arm in der Regel moralisch geführt. Christliche
und humanistische Kreise betonen das »schreiende
Unrecht« angesichts eines obszön
zur Schau gestellten Luxus, während sich
die Armut auch in den imperialistischen Zentren
– ganz zu schweigen von der sogenannten
Dritten Welt – rasant ausweitet. Im
Gegensatz zu dem Argument, dies sei eine »falsche
Neiddebatte«, ist die Argumentation,
die Anhäufung dieses Reichtums sei »ungerecht«,
völlig berechtigt.
Doch es handelt sich bei dieser wachsenden
Kluft von Reich und Arm auch um einen äußerst
bedeutenden Vorgang in der politischen Ökonomie,
der stark negative Folgen für die Menschen
hat. Es geht nicht darum, daß die reichen
Privatpersonen und die großen Unternehmen
mit Milliarden US-Dollar auf dem Konto Schatzbildung
für das private Vergnügen betreiben
oder wie Dagobert Duck gelegentlich zum puren
Vergnügen in ihre Geldberge eintauchen.
Karl Marx: »Mit der Ausdehnung der Warenzirkulation
wächst die Macht des Geldes, der stets
schlagfertigen, absolut gesellschaftlichen
Form des Reichtums. (...) Das Geld ist aber
selbst Ware, ein äußerlich Ding,
das Privateigentum eines jeden werden kann.
Die gesellschaftliche Macht wird so zur Privatmacht
der Privatperson.« (MEW 23, S. 145f.)
Vor allem aber gilt nun, was Marx im Zusammenhang
mit dem zitierten Widerspruch Produktion/Konsumtion
hervorhob: »Der letzte Grund aller wirklichen
Krisen bleibt immer die Armut und Konsumtionsbeschränkung
der Massen gegenüber dem Trieb der kapitalistischen
Produktion, die Produktivkräfte so zu
entwickeln, als ob nur die absolute Konsumtionsfähigkeit
der Gesellschaft ihre Grenze bilde.«
(MEW 25, S. 501)
Hinter der wachsenden Kluft von Arm und Reich,
hohen Gewinnen und Reallohnsenkungen steht
ein vierfacher Prozeß:
1. Das zugunsten von Unternehmern und Reichen
veränderte gesellschaftliche Kräfteverhältnis
und die damit verbundenen Damm- und Tabubrüche
unterschiedlicher Art (Tarifflucht, Aushöhlung
des Flächentarifvertrags, Zusammenlegung
von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe/Hartz
IV usw.) führen zu fortgesetzten Lohnabsenkungen.
Diese lassen die Gewinne und den Reichtum
explodieren.
2. Im Inland stagnieren oder sinken die Masseneinkommen.
Die Binnenkonjunktur lahmt. Der Widerspruch
zwischen immer mehr beschränkter Konsumtionskraft
und hohem Produktionsoutput wiederum führt
zu verschärften Wirtschaftskrisen.
3. Damit erhöht sich zugleich der Druck
auf die Löhne und der Drang auf den Weltmarkt.
Letzteres wiederum verschärft die Konkurrenz
und die Tendenz, diese Weltmarktkonkurrenz
militärisch abzusichern und gegebenenfalls
»auszutragen«.
4. Die gewaltigen Profite und die aufgehäuften
privaten Geldvermögen finden kaum Anlage
im Inland und suchen solche global.
Conrad Schuhler vom Institut für sozial-ökologische
Wirtschaftsforschung (isw) in München:
»Was machen die Reichen mit ihren Billionen?
Sie schicken das Geld rund um den Globus,
um die Anlage mit der höchsten Rendite
ausfindig zu machen. Weltweit kreisen 60 Billionen
Euro privates Geldvermögen – das
ist das Dreißigfache des deutschen Sozialproduktes
– um sich dort niederzulassen, wo der
höchste Profit herausspringt. Dies ist
der springende Punkt der Globalisierung des
Finanzmarktes.« Karl Marx beschrieb
den unbegrenzten Trieb der Schatzbildung im
»Kapital«, Band I, wie folgt:
»Der Trieb der Schatzbildung ist von
Natur maßlos. Qualitativ oder seiner
Form nach ist das Geld schrankenlos, d.h.
allgemeiner Repräsentant des stofflichen
Reichtums, weil in jede Ware unmittelbar umsetzbar.
Aber zugleich ist jede Geldsumme quantitativ
beschränkt, daher auch nur Kaufmittel
von beschränkter Wirkung. Dieser Widerspruch
zwischen der quantitativen Schranke und der
qualitativen Schrankenlosigkeit des Geldes
treibt den Schatzbildner stets zurück
zur Sisyphusarbeit der Akkumulation. Es geht
ihm wie dem Welteroberer, der mit jedem neuen
Land nur eine neue Grenze erobert.«
(MEW 23, S. 147)

Den "Kräften
des Marktes" ausgeliefert
Auch wenn für diese Entwicklung letzten
Endes die allgemeinen Rahmenbedingungen und
die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse
entscheidend sind, so sind es doch immer auch
konkrete Maßnahmen der Politik, die
zur Entwicklung eines »Turbokapitalismus«
– tatsächlich des ordinären
Kapitalismus – beitragen. Die Steuerreform
des Jahres 2000 befreite die Kapitalgesellschaften
von jährlich 15 Milliarden Euro Steuerzahlungen.
Sie erhöhte entsprechend die Profite
und ließ den Staat verarmen bzw. produzierte
den Druck zum Abbau des Sozialstaats. Die
US-Steuergesetzgebung war in dieser Hinsicht
Vorbild.
Die von der Bundesregierung 2002 beschlossene
Abschaffung der Versteuerung von Gewinnen
aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen
trug massiv zur Zerschlagung von Unternehmen
und zum Aufstieg der »Heuschrecken-Gesellschaften«
bei.
Die Bildung der Freihandelszone NAFTA zwischen
Kanada, den USA und Mexiko beschleunigte die
Standortkonkurrenz in Nordamerika. Die EU-Osterweiterung
wirkte in der gleichen Richtung in Europa.
Die Weigerung, Kerosin zu besteuern, und die
gezielte – von der EU-Kommission explizit
gedeckte – staatliche Förderung
von regionalen Airports hat den Aufstieg der
Billigflieger zur Folge. Die Abschaffung des
Sterbegeldes führt zum Aufstieg der Sargdiscounter
und zu Billigbestattungen in Osteuropa.
Die Anhebung der Mehrwertsteuer um drei Prozentpunkte
zum 1. Januar 2007 reduziert ein weiteres
Mal die Binnennachfrage der privaten Haushalte
und verschärft die Krisentendenzen. Der
Chef des Institutes für Wirtschaftsforschung
Halle, Udo Ludwig, äußerte mit
Blick auf diese Steuererhöhungen zum
Jahresende 2005: »2007 kommt ein gehöriger
Dämpfer. Wir erwarten zwar keine Rezession,
aber die Gefahr ist da.« Ein großes
Risiko sei dabei »vor allem die mögliche
Abschwächung der Weltwirtschaft.«
(FAZ, 20.12.2005)