|
Das
Euro-System bezeichnet hier die Gesamtheit der
Einheitswährung und der ihre Einführung
begleitenden Regeln (die meisten davon betreffen
die gesamte Europäische Union), insbesondere
den Fiskalpakt, die der Europäischen Zentralbank
(EZB) übertragenen Funktionen, die Beschränkung
des europäischen Haushalts und die Ablehnung
der Harmonisierung.
Die Analyse
umfasst elf Länder, darunter die Mitgliedsländer
des Euro- Währungsraums bei seiner Bildung
im Jahr 1999, ausgenommen Luxemburg und einschließlich
Griechenland, das erst 2001 hinzukam.1
Man unterscheidet zwei Hauptgruppen von Ländern.2
Der „Norden“ umfasst fünf Länder:
Deutschland, Österreich, Belgien, Finnland
und die Niederlande. Unter dem „Süden“
versteht man Spanien, Griechenland, Irland,
Italien und Portugal. Das elfte Land ist Frankreich,
das man beiseitelässt, weil es meist eine
Zwischenstellung einnimmt.
1.
Eine inkohärente Konstruktion
Die Einführung
des Euro war von zwei Grundregeln begleitet:
der Festlegung von Haushaltsmaßstäben
(3 % des BIP für das Defizit, 60 % für
die ausstehenden Schulden) und von Modalitäten
für das Funktionieren der EZB (Unabhängigkeit,
ein einziges Ziel (Kontrolle der Inflation)
und das Verbot der Finanzierung der öffentlichen
Defizite. Unter diesen Bedingungen, wo das Instrument
der Wechselkurse verschwunden war, blieben als
einzige Stellgröße nur die Löhne,
weshalb man im Übrigen auch von „interner
Abwertung“ spricht, um die Politik der
Lohnkürzungen zu benennen.
Diese
Konstruktion basiert auf einer Hypothese, die
von einer Reihe von Ökonomen schon damals
abgelehnt wurde, und viele haben dies später
auch entdeckt. Diese Hypothese war, dass die
haushalts- und lohnpolitische Disziplin zusammen
mit der Liberalisierung der Kapitalströme
ausreichen würde, um die wirtschaftliche
Konvergenz der an der Euro-Zone beteiligten
Parteien zu gewährleisten.
Es lief
nicht so wie geplant, und das Ziel dieses Artikels
ist es, die Verkettungen zu verstehen, die zu
der gegenwärtigen Krise geführt haben,
die an den Grundlagen des Euro-Systems selbst
rüttelt. Wir sehen hier ein scheinbares
Paradoxon: Die Länder des Südens erleben
einen Verfall ihrer preislichen Wettbewerbsfähigkeit,
obwohl die Lohnquote3 in diesen Ländern
sank. Diese Feststellung weist auf ein umfassenderes
Phänomen, das als Ausgangspunkt dient:
die Inflationsraten sind nicht konvergiert,
trotz eines allgemeinen Rückgangs der Anteil
der Löhne am Mehrwert (Husson, 2010). Dieser
Trend bedeutet, dass die Reallöhne langsamer
als die Arbeitsproduktivität gewachsen
sind, anders gesagt dass die an den Lohnkosten
gemessene Wettbewerbsfähigkeit a priori
keinen Grund hat, sich wegen einer Lohnsteigerung
zu verschlechtern. Lohnzurückhaltung hat
tatsächlich eine Rolle gespielt, war aber
alleine nicht ausreichend, um für die Konvergenz
der Inflationsraten sorgen.
Allerdings
kann sich die Wettbewerbsfähigkeit eines
Landes auf zweierlei Weise verschlechtern: entweder,
indem die Lohnstückkosten4 des
betrachteten Landes schneller steigen als die
seiner Konkurrenten oder indem die Inflation
in diesem Land höher ist. Die erste Ursache
ist ausgeschlossen: Im Allgemeinen sind die
realen Lohnstückkosten gleich geblieben
oder haben sich aufgrund sinkender Lohnquote
verringert. Nehmen wir das Beispiel Griechenland.
Man kann feststellen, dass die Lohnquote seit
Mitte der 1980er Jahre eine rückläufige
Tendenz hat und dass sich dies nach Einführung
des Euro im Jahr 2001 fortgesetzt hat. Nur in
den Jahren vor der Krise begann sie zu steigen
(Abbildung 1). Das gleiche Diagramm zeigt, dass
die Entwicklung der realen Lohnstückkosten
eine ähnliche Entwicklung genommen hat.
(Abbildung 1)

Unter
diesen Bedingungen konnte sich die preisliche
Wettbewerbsfähigkeit Griechenlands trotz
übermäßigen Anstiegs der Reallöhne,
also über die Steigerung der Produktivität
hinaus, nicht verschlechtern. Daher müssen
wir annehmen, dass dies das Ergebnis eines noch
stärkeren Anstiegs des Preisniveaus ist.
Dies lässt sich in Abbildung 2 überprüfen:
der Verlust der preislichen Wettbewerbsfähigkeit
gegenüber dem Durchschnitt des Euro- Raums
liegt nicht an Lohnsteigerungen, sondern im
Wesentlichen an einem noch schnelleren Anstieg
der Preise. (Abbildung 2)
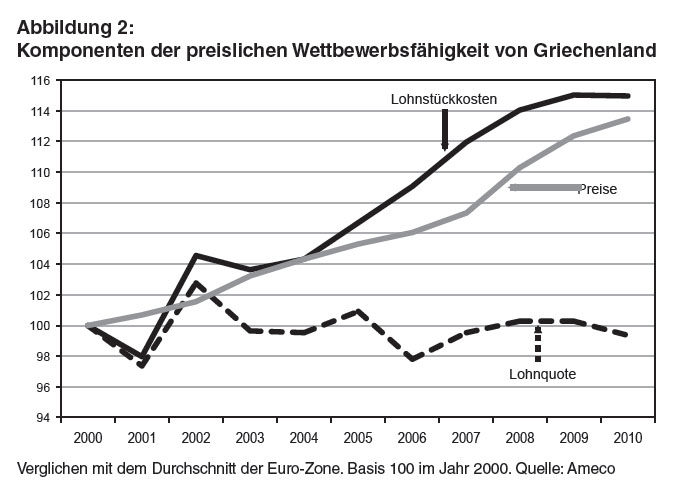
Diese
erste Linie wurde für den begrenzten Fall
von Griechenland herausgearbeitet, kann aber
auf die gesamte Zone verallgemeinert werden.
In allen Ländern, fast ohne Ausnahme, ist
die Situation ähnlich: Die realen Lohnstückkosten
ändern sich relativ wenig, so dass der
wesentliche Teil des Anstiegs der im aktuellen
Euro ausgedrückten Lohnstückkosten
auf Preiserhöhungen zurückzuführen
ist. Der Nord-Süd-Vergleich zeigt zwei
Phänomene: Im Süden sind die realen
Lohnstückkosten nahezu konstant, während
sie im Norden sinken, vor allem aufgrund der
in Deutschland verfolgten Lohnstopp-Politik.
Aber bei ansonsten gleichen Bedingungen sind
die Länder des Südens durch einen
schnelleren Preisanstieg charakterisiert (Abbildung
3).
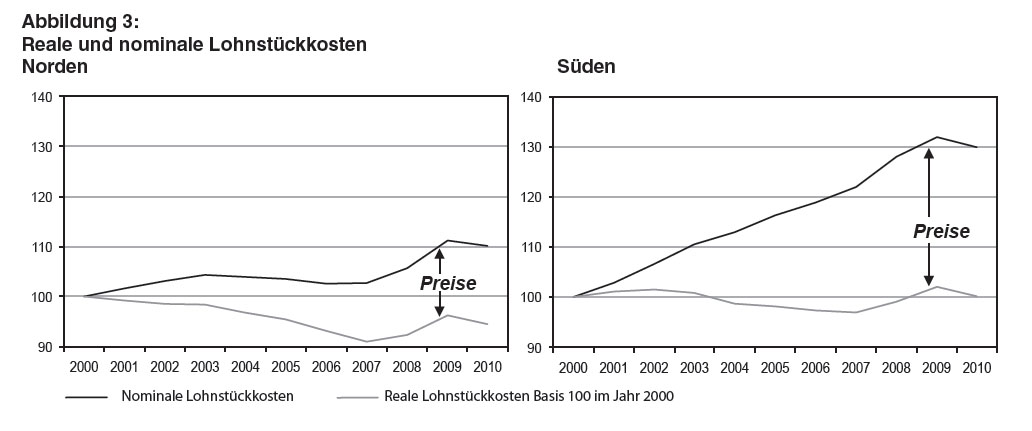
Eine solche
Sichtweise erlaubt es, unsere beiden ersten
Beobachtungen in Einklang zu bringen. Im letzten
Jahrzehnt zeigt die Entwicklung der Lohnquote
in keinem Land der Zone Anzeichen einer „Lohnexplosion“.
Anders gesagt sind die Reallöhne entsprechend
der Arbeitsproduktivität gestiegen. Allerdings
sind die Inflationsraten sehr unterschiedlich
und haben die Bandbreite der Lohnstückkosten
stark erweitert, die die Wettbewerbsfähigkeit
des jeweiligen Landes definieren.
Diese
Feststellung legt nahe, als Ausgangspunkt für
die Analyse das Vorliegen einer in jedem Land
spezifischen „strukturellen Inflation“
anzunehmen. Ein solcher Ansatz findet sich insbesondere
in den Arbeiten von Jacques Sapir (Sapir, 2006
und 2011) und einer aktuellen Studie zweier
Forscher der Asian Development Bank (Felipe,
Kumar, 2011).
2.
Die Determinanten der strukturellen Inflation
Das Ziel
einer Wirtschaftsunion zwischen Ländern
unterschiedlichen Entwicklungsstandes ist a
priori, zu einer Form der Harmonisierung und
Konvergenz zu kommen. Dieser Aufholprozess bedeutet
schnelleres Wachstum in weniger entwickelten
Ländern, das in der Regel von einer höheren
Inflationsrate begleitet wird. Diese Feststellung
enthält auch einen Anfangswiderspruch des
gewählten Wegs: wie kann man das Ziel der
Konvergenz, die von differenzierten Inflationsraten
begleitet ist, in Einklang bringen mit der Einführung
einer Einheitswährung, die implizit die
Konvergenz der Inflationsraten voraussetzt?
Der Aufholprozess
hat stattgefunden. Die Analyse des Zeitraums
1990- 2008 zeigt, dass Länder, die 1990
das niedrigste BIP pro Kopf hatten, auch die
höchsten Wachstumsraten verzeichneten.
Aber dieses Aufholen war von höherer Inflation
begleitet: Zwischen 2000 und 2008 stiegen die
Preise um 18,2 % in der gesamten Euro- Zone,
aber um 27 % im Süden gegenüber 11,8
% im Norden. Frankreich liegt über dem
Durchschnitt (18,4 %), Deutschland deutlich
darunter (8,3 %).
Diese
erste Erklärung der strukturellen Inflation
kann mit anderen kombiniert werden, die interne
Faktoren der jeweiligen Ökonomien berücksichtigt.
Die erste betrifft die Dynamik zwischen dem
verarbeitenden Gewerbe und dem Rest der Wirtschaft.
Es gibt im Allgemeinen eine Produktivitätsdifferenz
zwischen diesen beiden großen Sektoren.
Wir nehmen an, dass der Reallohn im verarbeitenden
Gewerbe in der Regel an eine schneller wachsende
Arbeitsproduktivität gebunden ist. Im Rest
der Wirtschaft kann man zwei unterschiedliche
Fälle unterscheiden.
Wenn der
Reallohn an eine langsamer wachsende Produktivität
gebunden ist, dann findet sich der Unterschied
in der Produktivität zwischen den Sektoren
in einem Unterschied im Lohnwachstum wieder.
Aber es ist auch möglich, dass die Löhne
im verarbeitenden Gewerbe als Motor wirken und
die Löhne im Rest der Wirtschaft mitziehen.
In diesem Fall, in dem der Lohnanstieg die Produktivitätssteigerung
übertrifft, wird die Inflation beschleunigt.
Es gibt eine umfangreiche Literatur zu diesem
Thema, und die Fälle können komplexer
sein, wobei dann auch die relativen Preise zwischen
den einzelnen Sektoren eine Rolle spielen. Aber
der allgemeine Gedanke ist ganz einfach: die
Ausbreitung der Gewinne durch Produktivitätssteigerungen,
in Form von Löhnen, aus Sektoren, wo sie
am höchsten sind, in den Rest der Wirtschaft,
ist eine Quelle der Inflation. Um diese Kausalität
zu erfassen, können wir einen einfachen
Indikator benutzen: das Lohngefälle, berechnet
als durchschnittliche Differenz zwischen dem
realen Lohnwachstum in der Gesamtwirtschaft
und im verarbeitenden Gewerbe im Zeitraum 1995-
2007. Man sieht, dass es eine enge und klar
getrennte Bindung zwischen den zehn Ländern
(mit Ausnahme Irlands, wegen fehlender Daten)
des Nordens und des Südens gibt.
Die Inflation
kann auch das Produkt eines Verteilungskonflikts
sein, der umso ausgeprägter ist, je ungleicher
die Einkommensverteilung ist. Man kann feststellen,
dass dieser Zusammenhang sehr überzeugend
besteht: Die Inflation ist höher in Ländern,
in denen der Gini- Koeffizient (ein zusammengesetzter
Indikator für die Einkommensungleichheit)
höher ist.
Insgesamt
gibt es drei Linien zur Erklärung der strukturellen
Inflation:
- Aufholprozess:
gemessen am pro- Kopf-Niveau des BIP;
- Sektorielle
Dynamik: gemessen am Lohngefälle zwischen
der Gesamtwirtschaft und dem verarbeitenden
Gewerbe;
- Verteilungskonflikt:
gemessen am Gini-Koeffizienten.
Die ökonometrische
Analyse bestätigt die Richtigkeit dieses
Ansatzes und belegt die Signifikanz der vorgestellten
Erklärungsansätze (Kasten 1). Man
kann also die Determinanten der strukturellen
Inflation wie folgt zusammenfassen:
- Die
Inflation ist höher in Ländern,
in denen das Wachstum durch den Aufholprozess
beschleunigt ist;
- Die
Inflation ist umso höher, je näher
das durchschnittliche Lohnwachstum an dem
der Löhne im verarbeitenden Gewerbe
ist;
- Die
Inflation ist höher in Ländern,
in denen der Grad der Ungleichheit zu größeren
Verteilungskonflikten führt. (Kasten
1)
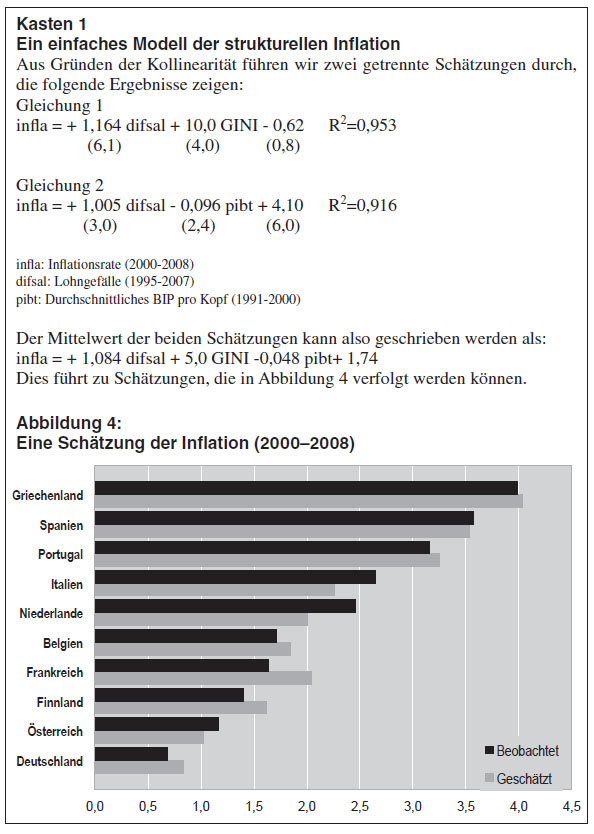
Die Unterschiede in
den Raten der strukturellen Inflation wurden
nicht reduziert. Dies hätte zu einer
Anpassung der Löhne führen können.
Aber die Lohnzurückhaltung war nicht
ausreichend, um die Inflationsunterschiede
auszugleichen, weil die Länder „im
Aufholprozess“ diesen Zwängen aufgrund
der Existenz von zwei „Schlupflöchern“
ausweichen konnten.
3.
Die Leistungsbilanz, das erste „Schlupfloch
“
Ohne die
Einführung der Einheitswährung hätten
diese Unterschiede in der strukturellen Inflation
zu Anpassungen des Wechselkurses geführt.
Bei Fehlen dieser Möglichkeit konnten sich
die Handelsbilanzdefizite ohne Rückstellkraft
bis zu einem gewissen Punkt vertiefen, da ja
das Defizit nicht zu einer Infragestellung der
nationalen Währung führte. Hätte
zum Beispiel Spanien die Peseta behalten, hätte
es kein Handelsbilanzdefizit von bis zu 10 %
des BIP im Jahr 2007 verzeichnen können:
seine Währung wäre angegriffen worden.
Das ist das erste „Schlupfloch“
gegenüber der Logik der Lohn- und Haushaltsdisziplin
des Euro-Systems.
In der
Zeit vor der Einführung des Euro war der
Handel in den beiden Hauptzonen in etwa ausgeglichen.
Aber dann vertieften sich die Unterschiede sehr
schnell, mit einem zunehmenden Defizit im Süden
und immer größeren Überschüssen
im Norden (Abb. 5). Frankreich belegt, wie üblich,
eine Zwischenstellung, aber der jüngste
Anstieg seines Defizits lässt es doch zunehmend
in Richtung Süden tendieren. Wie für
den Euro- Raum insgesamt ist sein Außenhandel
tendenziell ausgeglichen. (Abbildung 5)
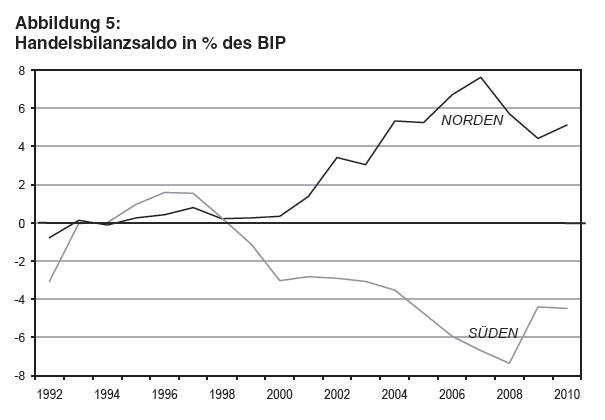
4.
Das Realzinsniveau , das zweite „Schlupfloch
“
Einer
der Regeln des Euro-Systems war es, den Kapitalverkehr
zu liberalisieren, während der Zinssatz
der EZB eine steuernde Rolle spielen sollte.
Diese Regel hat sich bewährt und führte
zu einer perfekten Angleichung der Zinssätze
(Abbildung 6A). Aber in dem Maße, wie
die Unterschiede in den Inflationsraten erhalten
blieben und sogar wuchsen, war die Angleichung
der nominalen Zinssätze von einer immer
größer werdenden Lücke bei den
Realzinsen nach Abzug der Inflation im jeweiligen
Land begleitet. Der allgemeine Trend war rückläufig,
aber er war noch
ausgeprägter in den Ländern des Südens,
wo die Inflation höher war (Abbildung 6B).
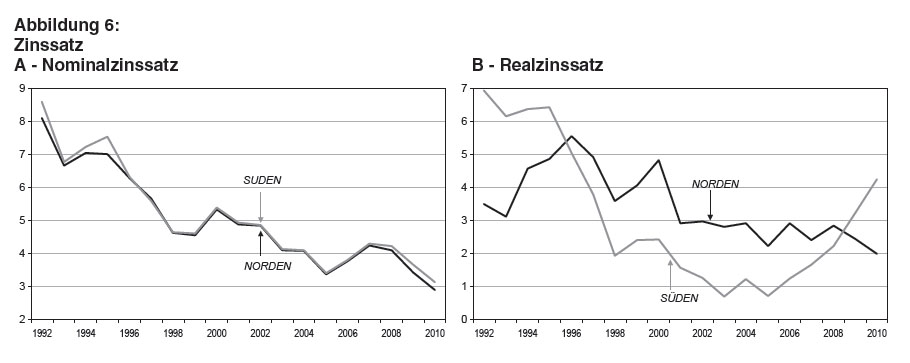
Zwischen
2000 und 2007 lag der reale Zinssatz bei durchschnittlich
2,7 % in den Ländern des Norden, aber bei
nur 1,2 % bei denen im Süden. Diese niedrigen
Zinsen haben zu einem starken Anstieg der Schuldenquote
der privaten Haushalte von 36 % im Süden
gegenüber nur 4 % im Norden geführt.
Es besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen
dem durchschnittlichen Niveau der Realzins und
dem Wachstum der Verschuldung der privaten Haushalte
(Abbildung 7). Das höhere Wachstum in den
Ländern des Südens wurde teilweise
unterstützt vom Prozess der Verschuldung,
der die Immobilienblasen, vor allem in Spanien,
genährt hat. (Abblidung 7)
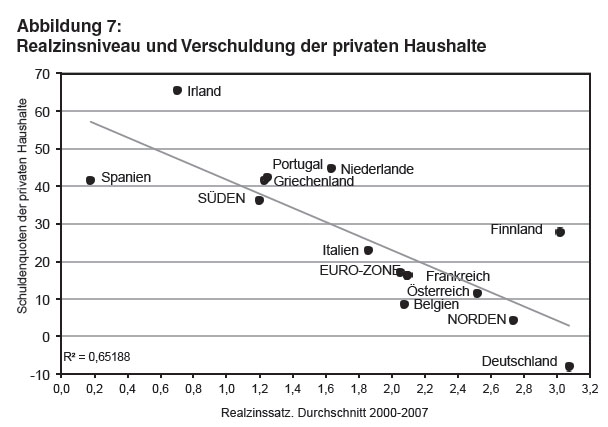
5.
Die deutsche Achterbahnfahrt
Die Geschichte
des von der deutschen Wirtschaft auf dem Weltmarkt
eingenommenen Platzes beginnt mit einem Handelsüberschuss,
gemessen an der Bilanz im Verhältnis zum
BIP. In der Zeit zwischen den beiden allgemeinen
Rezessionen (1974-75 und 1980- 81) ist der Überschuss
allmählich verschwunden. Die 1980er Jahre
erleben eine kräftige Erholung, so dass
der Überschuss am Vorabend der Wiedervereinigung
vergleichbar ist mit dem, den man heute beobachtet.
Die Wiedervereinigung im Jahr 1990 führt
zu einem fast sofortigen Verschwinden des Überschusses,
der in den 1990er Jahren durchweg sehr gering
bleibt. Zu Beginn der 2000er Jahre ereignet
sich eine Wende und führt zu einem dramatischen
Kurswechsel, der den deutschen Überschuss
am Vorabend der Krise auf bis zu 7 % des BIP
bringt (Abbildung 8).

Dieses
Wiedererstarken des deutschen Außenhandels
war von einem erheblichen Schwanken der Löhne
begleitet. Bis zur Einführung des Euros
hatten die meisten Länder Konvergenzbemühungen
in Form der Senkung der Lohnstückkosten
oder, was ungefähr auf das gleiche hinausläuft,
einer Senkung der Lohnquote umgesetzt. Doch
alles ändert sich in Deutschland Anfang
der 2000er Jahre: Die Lohnquote beginnt zu sinken,
ab dem Jahr 2004 sogar beschleunigt. In wenigen
Jahren fallen die realen Lohnstückkosten
um fast 10 %. Im Rest der Euro-Zone, einschließlich
des Südens, fallen die realen Lohnstückkosten
(d.h. die Lohnquote) nur sehr langsam (Abbildung
9).
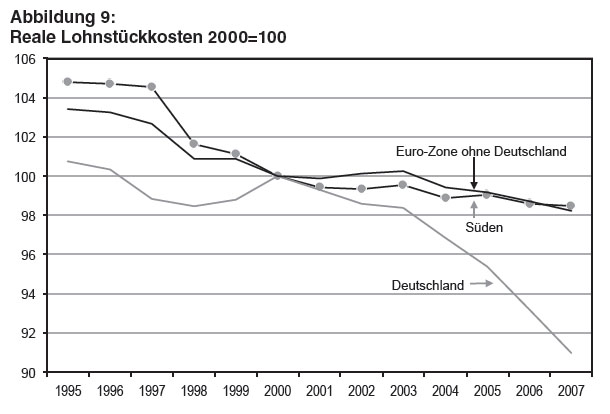
Diese
Beobachtung ist von entscheidender Bedeutung:
Die relative Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands
hat sich abrupt geändert. Und die unterschiedlichen
Inflationsraten verstärken noch den Unterschied.
Zwischen 1998 und 2007 sind die nominalen Lohnstückkosten
in Deutschland konstant geblieben, während
sie sich im Süden um 27 % und in der aus
Frankreich und dem Norden ohne Deutschland bestehenden
Gruppe um 15 % erhöhten.
Allerdings
reichen diese Veränderungen in den Verhältnissen
der Wettbewerbsfähigkeit nicht aus, um
die Entwicklung der Handelsbilanzen zu erklären.
Man muss ein weiteres Element hinzufügen,
das teilweise im Zusammenhang mit dem vorherigen
steht: das relative Wachstum der Inlandsnachfrage,
insbesondere des Verbrauchs. Und auch die Unterschiede
in der Zugbahn sind von Bedeutung. In den 10
Jahren zwischen 1997 und 2007 ist der Verbrauch
um 28 % in der Euro-Zone ohne Deutschland (30
% im Süden) gestiegen, aber nur um 9 %
in Deutschland. Dieser Unterschied stellt einen
zusätzlichen Vorteil für Deutschland
dar: die Erholung der Margen und die Quasi-Stagnation
des Verbrauchs erlaubten ihm, seine produktiven
Kapazitäten auszuweiten. Dies kann ökonometrisch
überprüft werden (Kasten 2): Die Lohnkosten
allein können nicht die Veränderungen
in der Handelsbilanz erklären; Ein weiteres
Argument muss hinzukommen, nämlich das
Wachstum des privaten Konsums. (Kasten2)
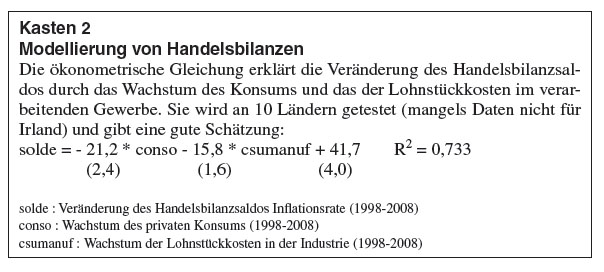
6.
Ein zusammengesetzter Abweichungsindikator
Um die
strukturellen Unterschiede zwischen den Ländern
weiter objektivieren zu können, konstruieren
wir einen zusammengesetzten Abweichungsindikator,
ausgehend von den folgenden vier Merkmalen,
die jeweils im Verhältnis gegenüber
dem Euroraum-Durchschnitt im Zeitraum 2000-2007
definiert werden:
- Wachstum:
Abweichung der durchschnittlichen Wachstumsrate;
- Inflation:
Abweichung der durchschnittlichen Inflationsrate;
- Haushaltsdefizit:
Abweichung der durchschnittlichen Salden
(in % des BIP);
- Handelsbilanz:
Abweichung der durchschnittlichen Salden
(in % des BIP).
Der zusammengesetzte
Indikator wird als Mittelwert dieser vier Elementarindikatoren
berechnet (nach Normalisierung, indem man die
Variablen zentriert und skaliert). Abbildung
10 erlaubt es, die Länder dieser Zone nach
diesem Abweichungsindikator zu klassifizieren.
Die Länder, die „positiv“ abweichen,
sind diejenigen, die Nutznießer eines
höheres Wachstums waren, begleitet von
Inflation und hohen Haushalts- und Handelsdefiziten.
Die Korrelation zwischen diesen vier Trend-Typen
ist natürlich nicht vollständig, und
es ist die Funktion des zusammengesetzten Indikators,
dies in einer einzigen Größe zusammenzufassen,
die zwangsläufig konventionell definiert
ist.
Die Rangfolge
der Länder spiegelt die Spaltung zwischen
Nord und Süd wider. Alle Länder des
Nordens haben einen negativen Indikator, was
bedeutet, dass ihr Wachstum etwas geringer ist,
sie aber „tugendhafter“ im Hinblick
auf Defizite und Inflation sind. Umgekehrt ist
der relative Indikator positiv für die
Länder des Südens. Frankreich befindet
sich wie gewohnt in einer Zwischenstellung,
obwohl es ein wenig in Richtung Süden tendiert,
und ist nicht weit entfernt von Italien. (Abbildung
10)
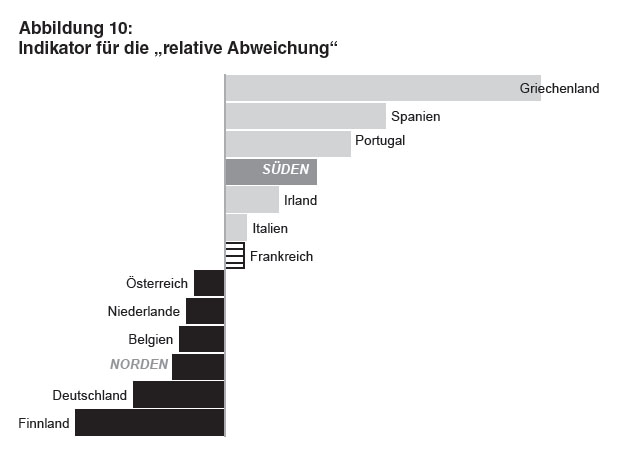
Man kann
verifizieren, dass dieser zusammengesetzte Indikator
gut mit anderen sozio-ökonomischen Indikatoren
korreliert. Wir haben uns für zwei entschieden.
Der erste ist die Armutsquote, mit der der Abweichungsindikator
positiv korreliert ist (Abbildung 11A). Ein
zweiter Zusammenhang kann mit einem Indikator
der sozialen Demokratie festgestellt werden,
der als Durchschnitt der beiden ermittelt wird,
die von Manfred Schmidt (2008) und Thomas Meyer
(2011) entwickelt wurden (Abbildung 11B).
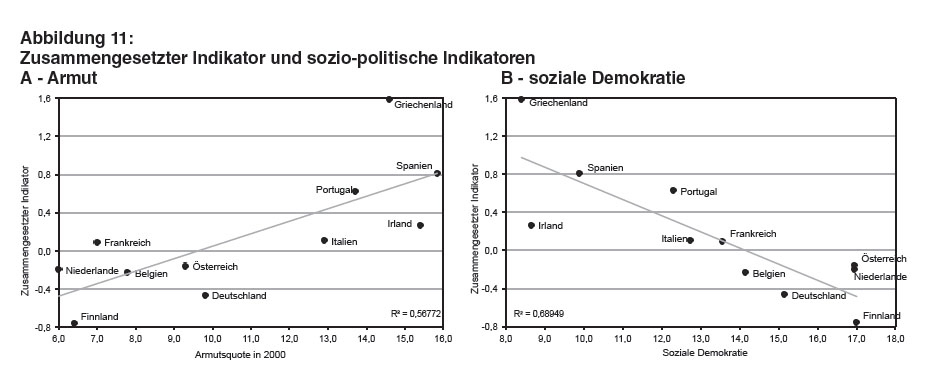
Dieser
Abweichungsindikator erlaubt es, die sozio-ökonomischen
Bedingungen in den einzelnen Ländern der
Euro-Zone analytisch zu beleuchten; dabei zeigt
er die strukturellen Unterschiede deutlich und
lässt, wie wir gesehen haben, jeden Trend
zur Konvergenz klar hervortreten. Es kann aber
auch benutzt werden, um die unterschiedlichen
Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf die öffentlichen
Finanzen zu erklären.
7.
VON DER REZESSION ZUR SCHULDENKRISE
Jede
Rezession hat unmittelbare Auswirkungen auf
das öffentliche Defizit. Doch vergleicht
man die Zunahme des Defizits von 2007 bis 2009
mit der Abnahme des BIP 2009 stellt man dabei
sehr große Unterschiede fest (Abbildung
12A). Im Großen und Ganzen sind die Budgetdefizite
in den südlichen Ländern viel stärker
gewachsen als in den Ländern des Nordens
(Abbildung 12B).
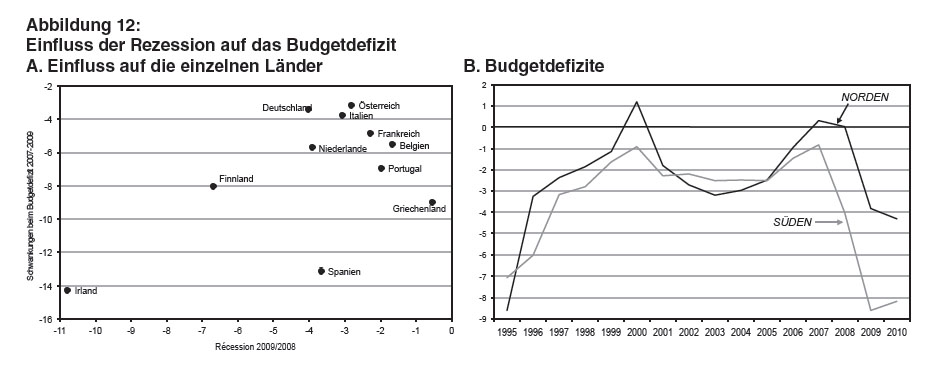
Wir wollen
hier nicht auf die verschiedenen Erklärungsversuche
für diese unterschiedlichen Auswirkungen
eingehen. Wir möchten vielmehr auf die
strukturellen Eigenschaften jeden Landes eingehen,
die mit dem oben definierten Abweichungsindikator
gemessen werden. Wir haben eine neue statistische
Gleichung getestet, mit welcher die Verschlechterung
des Budgets mit zwei Variablen erklärt
werden kann: mit dem Ausmaß der Rezession
und mit dem Abweichungsindikator. Diese Gleichung
zeigt interessante Resultate (Kasten 3).
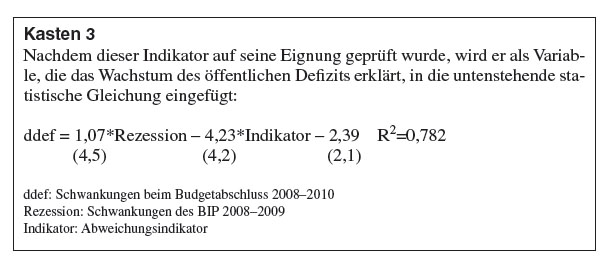
Dies ist
bedeutsam, weil sich zeigt, dass das Ausmaß
der Budgetverschlechterung mit den Besonderheiten
der nationalen Wirtschaften zusammenhängen.
(Kasten 3) Mit anderen Worten: Die Krise der
Staatsschulden ist der Ausdruck einer Systemkrise,
die aufgrund der Unterschiede zwischen den Mitgliedsländern
der Euro-Zone entstanden ist. Weltweit gesehen
ist das öffentliche Defizit übrigens
in der Euro- Zone weniger hoch als in anderen
großen kapitalistischen Ländern.
Bei seinem tiefsten Stand 2009 betrug es 6,4
% des BIP, weniger als in Japan (8,7 %), Großbritannien
(11,0 %) oder den USA (11,6 %). Noch einmal:
Das Ausmaß der Staatsschuldenkrise ist
eine Folge der besonderen
Regeln des Euro-Systems.
8.
DIE GESCHICHTE DES EURO: EINE SIMPLIFIZIERUNG
Obige
Analyse zeigt, dass unter den Ländern der
Euro-Zone tatsächlich eine Polarisierung
besteht, sodass zu Recht zwischen einem „Norden“
und einem „Süden“ unterschieden
werden kann. Die Länder des Südens
weisen Gemeinsamkeiten auf. Die wichtigste ist
eine höhere strukturelle Inflation. Diese
führt in diesen Ländern zu einem Verlust
an Konkurrenzfähigkeit und zu einer Erhöhung
der laufenden Defizite, obwohl die Lohnquote
im gleichen Ausmaß gesenkt wurde wie im
Durchschnitt der Euro-Zone. Doch in den Jahren
1995–2005 weisen diese Länder ein
höheres Wachstum auf. Dies kam dank zweier
„Schlupflöcher“ zustande: die
Kapitalzuflüsse decken die Außenhandelsdefizite,
die per definitionem die Landeswährung
nicht gefährden; die sinkenden Zinssätze
(im Gegenzug zum höheren strukturellen
Defizit) begünstigen ein Wachstum aufgrund
der Verschuldung.
Doch die
Krise schlägt durch und zerstört dieses
Zusammenspiel. Das wichtigste Ergebnis dieser
Analyse besteht zweifellos darin, dass die Schuldenkrise
der öffentlichen Haushalte das Anzeichen
für eine spezifische Krise des Euro-Systems
ist. Es ist selbstverständlich nicht die
einzige Dimension dieser Krise – die im
weitesten Sinn das Funktionieren des real existierenden
Kapitalismus in Frage stellt – aber sie
kommt nur in der Euro-Zone vor. In anderen kapitalistischen
Ländern wie die USA, Großbritannien,
Japan usw. gibt es diese Dimension nicht in
dieser Schärfe. Sie rührt vom schiefen
und widersprüchlichen Funktionieren der
Euro-Zone her, das nun seit rund zehn Jahren
andauert, aber nicht endlos andauern konnte.
Nehmen
wir kurz an, die Schuldenkrise könne überwunden
werden: Deswegen würden die Mängel
beim Funktionieren der Euro-Zone jedoch nicht
verschwinden, wenn nichts unternommen wird,
um diese Situation in den Griff zu kriegen oder
um einen Prozess des Zusammenwachsens einzuleiten.
Denn die Euro-Zone umfasst im Zeichen einer
Einheitswährung Länder mit unterschiedlichen
strukturellen Eigenschaften.
9.
DER ZWANG VON AUSSEN SCHLEICHT SICH DURCH DIE
HINTERTÜRE WIEDER REIN
Wie tief
die Krise ist, wird sichtbar, wenn der Zusammenhang
zwischen dem Budgetdefizit und dem Handelsbilanzdefizit
in jedem Land genau aufgezeigt wird. Dabei muss
von folgendem grundsätzlichen Verhältnis
ausgegangen werden6:
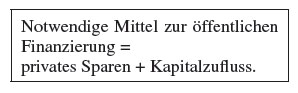
Diese
buchhalterische Gleichung zeigt, dass die Mittel
zur Finanzierung des öffentlichen Haushalts
(d. h. wenn das Budget defizitär ist) schlussendlich
aus zwei Quellen gedeckt werden: vom inländischen
privaten Sparen (Betriebe und Haushalte) und/
oder von den Kapitalzuflüssen in der Höhe
des Defizits der Leistungsbilanz. Dieses Verhältnis
ist buchhalterisch, d. h. es ist jederzeit überprüfbar.
Mit anderen Worten: Wenn sich einer dieser Teile
verändert, muss diese Veränderung
notwendigerweise von den beiden anderen Teilen
kompensiert werden. Dies sagt aber nichts über
die Anpassungsmechanismen aus, die für
diese Kompensation notwendig sind.
Aufgrund
dieses Verhältnisses können die Länder
des Nordens wiederum deutlich von den Ländern
des Südens unterschieden werden. Bis zum
Beginn der Krise haben sich die für die
öffentliche Finanzierung benötigten
Mittel in den Ländern beider Gruppen relativ
gleichmäßig entwickelt. Dann setzte
eine gegensätzliche Entwicklung ein. Im
Norden steigt nach Einführung des Euro
die landesweite Sparquote stark an, während
die Kapitalexporte als Gegenstück zu den
Handelsbilanzüberschüssen tendenziell
steigen: die Nettokapitalzuflüsse werden
negativ (Abbildung 13A).
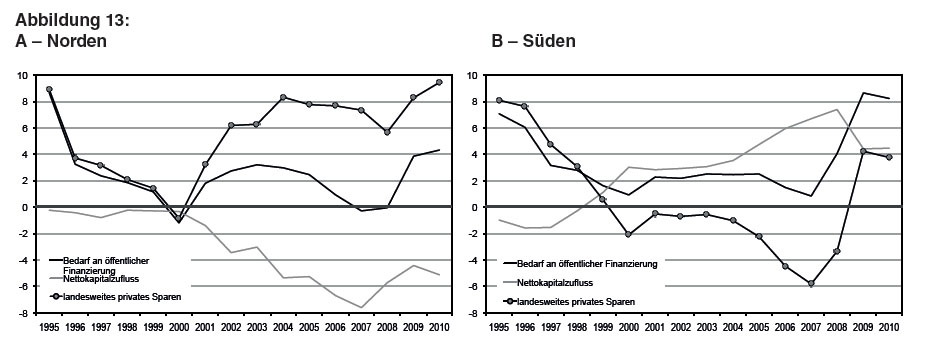
Im Süden
ist es umgekehrt und es zeigt sich eine klare
Aufteilung in unterschiedliche Perioden. Vor
der Einführung des Euro senken die Länder
im Süden ihre Budgetdefizite auf den Stand
der Vorgaben. Dies geht einher mit einer Abnahme
des privaten Sparens, die mit einem zusätzlichen
Kapitalzufluss kompensiert wird. Bis zum Beginn
der Krise steigen die öffentlichen Defizite
nicht an. Doch ab 2005 erfolgt langsam eine
Rückkehr zur Situation vor dem Euro: Die
Außenhandelsdefizite steigen, was zu Kapitalzuflüssen
führt, die das abnehmende private Sparen
kompensieren. Die Krise beginnt mit einem starken
Anstieg des öffentlichen Defizits. Gleichzeitig
sinken die Außenhandelsdefizite und im
Gefolge die Kapitalzuflüsse. Der Kreis
schließt sich mit einem starken Rückgang
der privaten Sparquote (Abbildung 13B).
Hier kommt
es zu einem grundlegenden Element der Krise:
Sie setzt dem quasi bis anhin automatischen
Kapitalzufluss ein Ende. Mit anderen Worten:
die Länder des Südens, die von der
Schuldenkrise am stärksten betroffen sind,
müssen ihr Handelsbilanzdefizit ebenfalls
senken. Dies kann aber nur mit öffentlichem
Sparen erreicht werden. Diese Anpassung ist
aber nur mit einem markant tieferen Wachstum
machbar. In den Ländern des Südens
besteht in der Tat eine sehr enge Beziehung
zwischen der Wachstumsrate und den Schwankungen
der privaten Sparquote.
Die Schlussfolgerung
aus dieser Analyse ist klar: Die Länder
des Südens hatten zwar von 1995 - 2005
ein höheres Wachstum als die Länder
des Nordens (Abbildung 14A), doch dieses Wachstum
konnte nicht aufrechterhalten werden, denn es
beruhte auf einem Rückgang der landesweiten
Sparquote (Abbildung 14B).
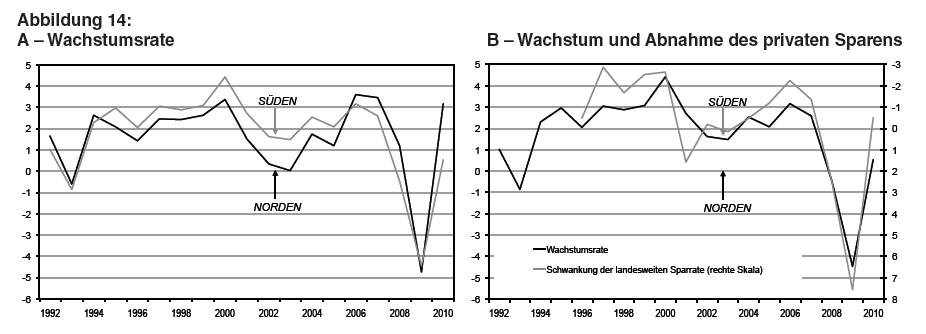
Diesem
Rückgang beim Sparen in den Ländern
des Südens entsprach ein wachsender Kapitalzufluss,
der durch die Finanzderegulierung und die Angleichung
der Zinssätze erleichtert wurde. Aber sobald
dieser Kapitalzufluss dünner wird, funktioniert
der Ausgleich des Saldogleichgewichts anders:
Die notwendigen öffentlichen Mittel können
nicht mehr nur mit einer massiven Steigerung
der landesweiten Sparquote beschafft werden
– rund 10 % des BIP – die ihrerseits
das Wachstum drückt (Abbildung 14B).
Diese
neue Konstellation kann dauern und die Chancen,
erneut zu Wachstum zu kommen, sind in den Ländern
des Südens umso geringer. Letztere haben
ein riesiges Defizit in Form von Nettoauslandguthaben
angehäuft: Es macht fast 60 % des BIP aus,
während die Länder des Nordens über
positive Nettoauslandguthaben im Wert von 35
% des BIP verfügen (Abbildung 15).
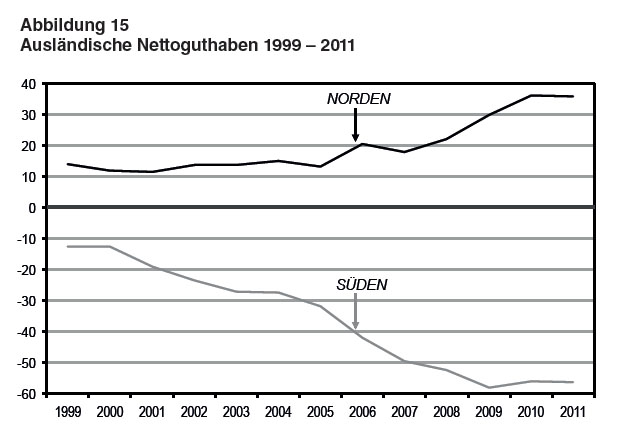
10.
VOR DEM DEBAKEL
Der Wurm
steckte von Anfang an drin: „...
weder in der Theorie noch in der Praxis kann
die Meinung vertreten werden, wonach mit der
Einheitswährung das wirkliche Zusammenwachsen
der europäischen Länder erzwungen
werden könne“ (Husson, 1996). Mit
der Einheitswährung „wird die Schaffung
eines einheitlichen Raumes zum Ziel erklärt,
zu dem sie beitragen soll“ (Husson, 2001).
Im Rückblick
erweist sich die Einführung des Euro wahrscheinlich
als schrecklicher Fehler, der aus dogmatischer
ja sogar neurotischer Blindheit erfolgte, der
aber sicher einem völligen Unverständnis
dafür entsprang, welche Herausforderungen
der Aufbau eines vereinigten Europa mit sich
bringt. Heute ist die Euro-Zone zum schwachen
Glied der Weltwirtschaft geworden. Man kann
sogar sagen, dass Europa dabei ist, seine eigenen
Kinder zu fressen. Die verschiedenen in Europa
verfolgten Politiken gleichen einer blinden
Flucht nach vorn, die die ganze Region in eine
höllische Spirale aus Sparen/Rezession
stürzt. Die Arbeitslosigkeit verharrt auf
einem noch nie erreichten Niveau und der einzige
Ausweg ist eine Schocktherapie, die das soziale
Modell kaputt macht.
Die kürzliche
Diskussion, wonach zur wachsenden Zahl von Spar-
und Memorandumsabkommen zur Budgetsanierung
nun noch das Wachstum „dazukommen“
müsse, ist völlig falsch, denn das
„gewünschte Wachstum“ soll
mit „Strukturreformen“ erreicht
werden, die die Euro-Zone nur in die Rezession
treiben können. Hier zeigt sich eine neue
Form dogmatischer Starrköpfigkeit, die
die Frage der Rhythmen völlig außer
Acht lässt, indem zwischen den Hebeln für
eine konjunkturelle Erholung und einem neuen
„möglichen Wachstum“ überhaupt
nicht mehr unterschieden wird, dessen hypothetische
Auswirkungen sowieso erst mittel- oder langfristig
spürbar würden. Angesichts eines solchen
Wahnsinns muss man nicht nur „niedergeschlagen
sein“ wie zahlreiche Ökonomen in
Frankreich, sondern einfach erschrocken.
Die Geschichte
neu schreiben zu wollen, wäre sinnlos.
Es müssen jetzt vielmehr die Möglichkeiten
geprüft werden, wie aus dieser Sackgasse
herausgefunden werden kann. Es lassen sich mehrere
mögliche Szenarien unterscheiden: Mit dem
Strom schwimmen und das Ganze verwalten, Strukturanpassung,
Austritt aus dem Euro und radikale Neugründung
Europas (mit gemeinsamer Währung). Keines
dieser Szenarien weist den Königsweg.
Die europäische
Politik schwankt zwischen Strukturanpassung
und mit dem Strom schwimmen. Einmal gießt
sie Öl ins Feuer, tags darauf holt sie
den Feuerlöscher hervor. Die jüngere
Geschichte Europas ist eine Abwechslung von
verstärkten „Spar“- Maßnahmen
und Rettung der Situation am Rande des Abgrunds.
Der fehlende Zusammenhang zwischen den verschiedenen
Beschlüssen und die völlige Unfähigkeit,
der Entwicklung zuvorzukommen, sind Anzeichen
eines tiefen Dilemmas: Wie kann zum „business
as usual“ zurückgekehrt werden, wo
doch gerade dieses zur Krise geführt hat?
Diese Schwankungen auf einem unmöglichen
Weg tragen dazu bei, dass sich etwas abzeichnet,
was man „eine chaotische Regulierung“
nennen kann und das in etwa der Kapitalismus
nach der Krise sein kann (Husson, 2009). Wenn
man nicht resigniert den Sturz in eine soziale
Regression hinnehmen will, müssen Alternativen
angestrebt werden.
Die erste,
an die gedacht wird, ist der Austritt aus dem
Euro. Weil der Euro nicht umsetzbar ist, muss
er verschwinden. Bei dieser einfachen Logik
wird jedoch vergessen, dass sich zehn Jahre
lang Widersprüche angehäuft und zu
einem öffentlichen und privaten Schuldenberg
geführt haben, der im Bankensystems unentwirrbar
vermischt ist. Der Austritt aus dem Euro als
solcher führt nicht an den Start zurück.
In dieser Frage wurden schon unzählige
Argumente ausgetauscht, natürlich besonders
im Fall Griechenland. Das wichtigste Argument
besagt, dass das Zurück zu Landeswährungen
Abwertungen ermöglicht, um die jeweilige
Konkurrenzfähigkeit zu stärken und
so den Export anzukurbeln und das Defizit durch
die entsprechenden National(Zentral-) banken
decken zu lassen. Doch eine solche Maßnahme
an sich würde die Last der bereits angehäuften
Schulden nicht abbauen und de facto zu einer
„Spar“-Politik führen, die
mit der Strukturanpassung vergleichbar wäre.7
Die neue Währung wäre schutzlos der
Spekulation ausgeliefert, die zu einem endlosen
Zyklus von Abwertung/ Inflation führen
würde. Wenn alle Länder aus dem Euro
aussteigen würden oder anders gesagt: Ein
vollständiges Auseinanderfallen der Eurozone
ist für Europa ganz klar keine Lösung.
Dies würde zu einem chaotischen Handelskrieg
führen. Allgemein formuliert tendiert die
Ausstiegsstrategie dazu, die soziale Frage in
eine nationale Frage zu verwandeln, wie dies
detailliert drei griechische Wirtschaftswissenschaftler
zeigen, die übrigens Syriza-Mitglieder
sind (Laskos, Milios, Tsakalotos, 2012). Mit
der Austrittsdrohung kann jedoch ein Kräfteverhältnis
entstehen, das der Abschreckung dient: Der Austritt
eines Landes aus dem Euro hätte in der
Tat große Auswirkungen auf die übrigen
Länder.

11.
HINTER DER STAATSSCHULDENKRISE VERBIRGT SICH
EINE KRISE DES EURO-SYSTEMS
Weil ein
Zurück in die Vergangenheit keine Lösung
und das gegenwärtige Euro-System widersprüchlich
ist, muss eine Neugründung Europas angestrebt
werden. Aufgrund der bisherigen Analyse müssen
zwei Ziele unterschieden werden, die beide nur
erreicht werden können, wenn mit dem heutigen
Euro-System gebrochen wird.
Das eine
Ziel besteht in der Tilgung der angehäuften
Schulden, die jede Aktivität und jede Neuausrichtung
der Entwicklung behindert. Dies setzt radikale
Lösungen voraus, d. h. die Umschuldung
und die Vergesellschaftung der Banken. Diese
Radikalität entspringt jedoch keineswegs
dem Willen, alle anderen Lösungsvorschläge
zu überbieten, sondern der Sorge um eine
Lösung, die in sich schlüssig ist,
wo alles stimmt.
Das zweite
Ziel bezieht sich auf die Art der Schuldentilgung:
Entweder erfolgt sie zum heutigen Zinssatz in
kleinen Schritten, d. h. zum Preis eines mindestens
zehn Jahre dauernden wirtschaftlichen, sozialen
und politischen Rückschritts. Oder die
Schulden werden auf einen Schlag brutal umgelagert
oder gestrichen, sodass alles auf Null steht.
In dieser Logik ist die Vergesellschaftung der
Banken aus einem technischen Grund notwendig:
Nur so kann das Schuldengewirr entwirrt werden,
weil der Großteil der Staatsschulden von
den Banken getragen wird. Dies zeigt sich am
Beispiel Bankia in Spanien oder Crédit
agricole in Frankreich. Noch klarer zeigt sich
das am absurden Paradox, dass die EZB den Banken
massiv unter die Arme greift (1000 Milliarden
Euro) anstatt den darbenden Staaten zu helfen.
Eine dritte Möglichkeit wäre, dass
die EZB den Staaten direkt finanzielle Hilfe
zukommen lässt.
Es wird
natürlich alles unternommen, um Pseudolösungen
zu finden. Es könnte in der Tat ein ganzes
keynesianisches Arsenal aufgefahren werden:
Kapitalaufstockung bei der Europäischen
Investitionsbank und deren Darlehen (60 Milliarden
Euro); Öffnung der noch nicht aktivierten
Strukturfonds (82 Milliarden); eine Finanztransaktionssteuer
(50 Milliarden pro Jahr); Project Bonds (Projektobligationen)
zur Finanzierung von Großinvestitionen.
Man könnte – und das wird wahrscheinlich
auch geschehen – den Zeitraum für
die Rückkehr zu ausgeglichenen Budgets
verlängern. Man würde die Kosten für
die Hilfe an die Banken gescheiter unter ihnen
aufteilen anstatt ihnen blind Riesensummen zu
leihen. Der Eurorettungsfonds (EFSF) oder der
Europäische Stabilitätsmechanismus
(ESM) könnten für die direkte Rekapitalisierung
der notleidenden Banken eingesetzt werden, ergänzt
mit einem gemeinsamen System zur Sicherung der
Depots. Senkung des Euro-Kurses, Inflation,
Anpassung der Löhne in Deutschland: Alle
diese Faktoren könnten die Politiken des
„mit dem Strom Schwimmens“ unterstützen,
doch sie würden den Anpassungskalender
nur marginal verändern.
12.
BRUCH MIT DEM EURO-SYSTEM ZUGUNSTEN EINES ANDEREN
EUROPA-PROJEKTS
Lehnt
man die Strukturanpassung und den Austritt aus
dem Euro ab, bleibt als einziger in sich schlüssiger
Weg nur die kooperative Harmonisierung. Sie
würde auf einem europäischen Budget
beruhen, das mit einer Einheitssteuer auf Kapitaleinkommen
gespiesen würde und aus dem die notwendigen
Transfers (Harmonisierungsfonds) und die gesellschaftlich
und ökologisch nützlichen Investitionen
finanziert würden. Beim Aufbau eines gemeinsamen
Wirtschaftsraums und als Ergänzung zur
Einheitswährung ist ein solcher „Föderalismus“
im Grunde genommen unerlässlich. Stellen
wir uns nur einmal kurz ein Land wie Frankreich
vor, wo jede der 21 Regionen für ausgeglichene
Finanzen und den ausgeglichenen Austausch mit
„draußen“ selber verantwortlich
wäre, während das landesweite Budget
auf 1 % des BIP begrenzt wäre. So wird
klar, wie absurd eine solche Konstruktion wäre,
auf dem jedoch das Euro-System ruht.
Dagegen
wird eingewendet, ein solches Projekt sei naiv
und in der heutigen Situation ausgeschlossen.
Es gebe überhaupt keinen Ausweg, weder
in den einzelnen Ländern noch in Europa.
Noch einmal: wenn dem so wäre, bestünde
die einzige mögliche Orientierung darin,
die Laufzeit der „Spar“- Programme
zu verlängern in der Hoffnung, dass sie
mit einem Beginn des „Wachstums“
zusammenfallen, wie dieses auch konkret aussehen
mag. Das wäre aber ein nie endendes „Spar“-Programm.
Patrick Artus zeigt auf, dass die Entwicklung
im Fall von Spanien (Schuldentilgung, Abbau
des öffentlichen Defizits, Schaffung neuer
Arbeitsplätze) „vielleicht Jahrzehnte
dauern werden“ (Artus, 2012). Und das
ist logisch: Mehrere Jahrzehnte angehäufter
und in Schulden umgewandelter Ungleichgewichte
führen zu ebenso vielen Jahrzehnten der
Entschuldung.
Um aus
dieser Sackgasse herauszukommen, gibt es eine
Diagonale, die zusammengefasst im einseitigen
Bruch mit dem real existierenden Europa besteht
und zwar zugunsten eines anderen Projekts für
Europa. Man kann das ein Übergangsprogramm
nennen, bei dem die Regeln des Euro- Systems
abgelehnt werden und gleichzeitig der Wille
besteht, die alternative Erfahrung auf das ganze
Gebiet auszuweiten. Dabei wird nicht auf das
wundersame Erscheinen eines „guten“
Europa gewartet. Man verfolgt einen „Ausdehnungsprotektionismus“,
bei dem die Erfahrung gesellschaftlicher Veränderung
beschützt und gleichzeitig deren Ausweitung
vorgeschlagen wird (Husson, 2011, 2012).
Der Notplan,
den Syriza vor den Wahlen vom 17. Juni 2012
in Griechenland vorgeschlagen hatte, beinhaltete
genau dieses Vorgehen. Er enthielt insbesondere
folgende drei Punkte8:
- Annullierung
des „Spar“-Programms, aller
„Spar“-Maßnahmen und der
Gegenreform bei den Arbeitsgesetzen
- Verstaatlichung
der Banken
- Ein
Schuldenmoratorium mit dem Ziel, die illegitimen
Schulden festzustellen und zu annullieren
Die wichtigste
Schlussfolgerung aus dieser Analyse ist die
Feststellung, dass sich hinter der Staatsschuldenkrise
eine tiefere Krise versteckt, die Krise des
Euro-Systems. Die Krise des Kapitalismus hat
ein widersprüchliches Projekt implodieren
lassen. Man wollte unterschiedliche Länder
in einer Währungsunion vereinigen, ohne
sich die notwendigen Mittel zu geben, damit
die Länder zusammenwachsen oder damit ihre
Beziehungen untereinander organisiert werden
können. Die notwendige Neugründung
Europas kann nur gelingen, wenn unpassende Regeln
abgelehnt werden, die die Gräben zwischen
den Mitgliedsländern der Euro-Zone nur
noch vertieft haben. Für die Alternative
braucht es aber noch mehr: Weitere Brüche
und insbesondere eine andere Verteilung des
Reichtums. Der Bruch mit dem Euro-System findet
seine Legitimität nur im Bruch mit dem
neoliberalen Kapitalismus und in der kooperativen
Ausdehnung des Projekts. Die Prinzipien eines
solidarischen Europa sind unvereinbar mit einer
rein kapitalistischen Logik. Das macht die Zukunft
so ungewiss und herausfordernd.
Juli 2012
Übersetzung:
Björn Mertens und Ursi Urech
1 Man
lässt ebenfalls die fünf Länder
beiseite, die erst später der Euro-Zone
beigetreten sind: Slowenien im Jahr 2007, Zypern
und Malta im Jahr 2008, die Slowakei im Jahr
2009 und Estland im Jahr 2011.
2 Daten
für Nord und Süd werden durch Aggregation
berechnet, wobei nach der wirtschaftlichen Bedeutung
gemessen am BIP gewichtet wird. Der Anteil des
Nordens an der gesamten Euro-Zone (11 Länder)
macht 43,4 % aus (Deutschland: 28,3 %, Österreich
3,0 %, Belgien 3,8 %, Finnland 1,9 %, Niederlande
6,4 %). Für den Süden sind es 35,3
% (Spanien 11,0 %, Griechenland 2,3 %, Irland
1,9 %, Italien 18,0 %, Portugal 1,9 %). Frankreich
steht für 21,3 %. Die Gültigkeit dieser
a priori definierten Einteilung wurde während
der Vorbereitung dieser Studie überprüft.
3 Anteil
der Löhne am Nationaleinkommen –
d.Üb.
4 Siehe
Anhang 1 für die Definition der Lohnstückkosten.
5 Sofern
nicht anders angegeben sind die Daten der von
der Europäischen Kommission bereitgestellten
Ameco-Datenbank entnommen.
6 Siehe
Anhang 2 zu deren Aufbau
7 Zur
Frage des Austritts aus dem Euro siehe Husson,
2011 und 2012
8 Es ist
auffällig, wie die internationale Presse
alles getan hat, um aus dem Austritt aus dem
Euro den wichtigsten Punkt dieser Debatte zu
machen, während diese Frage im Programm
von Syriza nicht einmal erwähnt wurde.

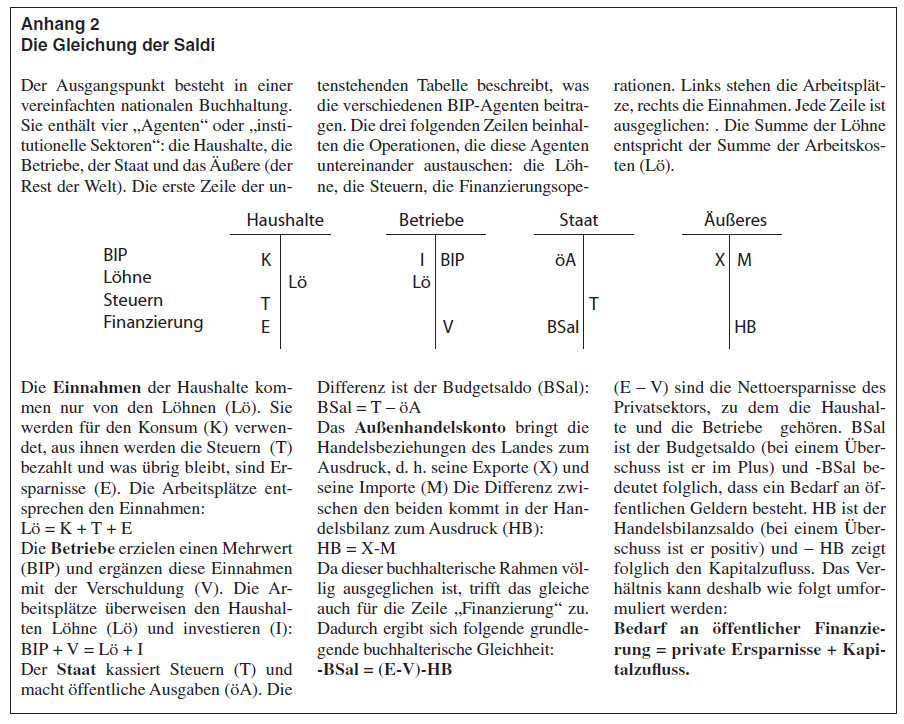
|