|
Dieser demonstrative Optimismus war ebenfalls
absehbar. Bereits vor sechs Monaten schrieben
wir: „Man kann darauf wetten, dass bereits
das erste Quartal mit einem Nullwachstum als
Rückkehr zur Normalität gefeiert werden
wird.“2
Zugleich fügten wir aber hinzu, dass „diese
Hoffnung kurzlebig sein wird und man, sobald
die Konjunkturmaßnahmen verpufft sind,
merken wird, dass die Krise nicht wirklich überwunden
ist.“ Wir befinden uns momentan am Ende
der technischen Rezession3
und am Beginn einer vorübergehenden Aufschwungphase
en miniature (s. Grafik 1). Und in Wahrheit
fängt die Krise erst an.
| Grafik
1:Anstieg der Produktion |
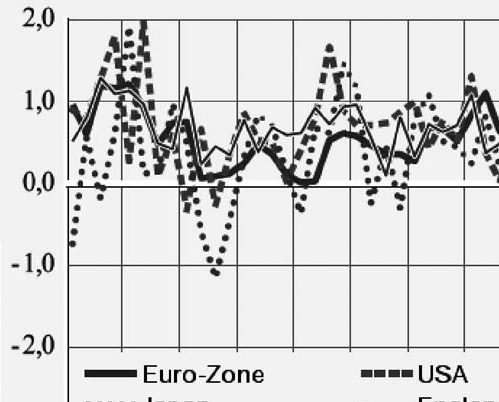 |
Vierteljährliche
Veränderungen in %
Quelle: Bulletin mensuel de la BCE, September
2009, http://gesd.free.fr/bcem99.pdf |
Die
Funktionsweise des Kapitalismus vor der Krise
Wir
beziehen uns im Folgenden auf eine Funktionsanalyse
des gegenwärtigen Kapitalismus, wobei wir
zum besseren Verständnis die wesentlichen
Interaktionen nochmals benennen. Sie lassen
sich in dem unten stehenden Schema zusammenfassen
(Schema 1):
-
die Profitrate steigt aufgrund der allgemeinen
Lohnsenkungen (1)
-
dieser Anstieg der Profitrate führt
nicht zur weiteren Zunahme der Akkumulation
sondern zur Freisetzung von vagabundierendem
Kapital (2) mangels hinreichend rentabler
Investitionsmöglichkeiten (3)
-
dieser Shift wurde durch die Deregulierung
ermöglicht und führt zu Finanzblasen
(4) und immer höheren Rentabilitätserwartungen
(5)
-
durch die Superrenditen im Finanzsystem
entsteht eine Schicht von Rentiers, deren
Konsumverhalten die stagnierende Nachfrage
seitens der Lohnabhängigen partiell
ausgleicht (6). Die Kehrseite liegt in der
Vertiefung der Ungleichheiten und der Überschuldung
der Lohnabhängigen (7).
-
Dieser Kreislauf schaukelt sich immer weiter
hoch: die Überschuldung führt
durch die Schaffung ständig neuer Finanzprodukte
zur weiteren Deregulierung (8), während
durch die zunehmenden Rentabilitätsansprüche
ausreichend profitable Anlagemöglichkeiten
im Produktionssektor weiter zurückgehen
(9) und dadurch erneuter Druck auf die Löhne
entsteht (10).
| Schema
1: Interpretationsschema der Funktionsweise
des gegenwärtigen Kapitalismus |
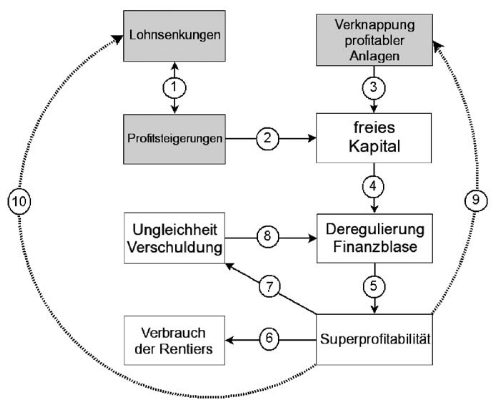 |
Die
gegenwärtige Krise rührt an den beiden
Grundfesten des herrschenden Wachstumsmodells:
der nahezu durchgängigen Umverteilung der
Reichtümer zu Lasten der Arbeiter und der
Erzeugung eines zunehmenden Ungleichgewichts
auf internationaler Ebene, namentlich zwischen
den USA als größter Weltmacht und
dem Rest der Welt. Auf dieser Grundlage hat
sich das Finanzsystem entwickelt, dessen Funktion
die Gewährleistung der gesamten Reproduktion
war, indem es die Finanzprofite zirkulieren
ließ, die Überschuldung forcierte
und die Defizite unterhielt.
Dieses
Akkumulationsmodell entstand als Reaktion auf
die allgemeine Rezession 1974/75, die zur Aufkündigung
des bis dahin gültigen „fordistischen“
Arrangements geführt hatte. Dieses basierte
umgekehrt auf einer stabilen Aufteilung des
Mehrwerts und steter Zunahme der Nachfrage seitens
der Lohnabhängigen. Den Ausweg daraus suchte
der Kapitalismus in der Einführung des
neoliberalen Modells, dessen offenkundige Widersprüche
durch die Globalisierung und die zunehmende
finanzwirtschaftliche Ausrichtung „gemanagt“
wurden. Realiter wurden diese Widersprüche
nur auf die lange Bank geschoben, um den Preis
stetig wachsender Spannungen, die schließlich
zu dem Zusammenbruch von 2008 geführt haben.
Retrospektiv war das Finanzwesen das wichtigste
Instrument zur Aufschiebung der Widersprüche.
Grundsätzlich
kann der Kapitalismus nur auf zwei Arten funktionieren:
„à la Keynes“ wie in den
„glorreichen 30er Jahren“ oder nach
neoliberaler Manier wie seit dem großen
Umbruch der 80er Jahre. Aus dieser Analyse ergeben
sich mehrere Annahmen, die sich in Form dreier
Thesen zusammenfassen lassen, die im Folgenden
erhärtet werden sollen:
-
Die Rückkehr zum Keynesianismus der
„glorreichen 30er Jahre“ ist
nicht möglich.
-
Daher besteht der einzige Ausweg in der
weiteren Verschärfung des neoliberalen
Modells, das
-
nicht mehr funktionieren kann, womit der
Kapitalismus in einer Sackgasse steckt.
Das
Damoklesschwert über dem Finanzsystem
Zunächst
gilt, dass „sich die Sorgen um die Gesundung
des Bankensystems nicht komplett erübrigt
haben“, wie die OECD4
unterstreicht, nachdem sie die bisherigen Fortschritte
hervorgehoben hat: „Die Senkung der Zinsen
auf dem Geldmarkt, der geringe Zinsabstand zwischen
den Unternehmensanleihen, der Aufschwung an
den Börsen und die moderater als erwartet
ausgefallene Kreditverknappung seitens der Banken
haben dazu beigetragen, dass das Finanzsystem
als Ganzes deutlich besser dasteht.“ Die
Sanierung der Banken zu Lasten zunächst
der öffentlichen Haushalte und anschließend
der ArbeiterInnen beseitigt also nicht alle
Unsicherheitsfaktoren hinsichtlich der Stabilität
des Finanzsystems.
Diverse
Risiken sind weiter vorhanden. Das erste ist
ein Wiederaufleben der Bankenkrise. Deren Bilanzen
sind weiterhin zuhauf mit toxischen Papieren
und faulen Krediten belastet und diese Situation
kann sich noch weiter zuspitzen durch die absehbare
Überschuldung der Privathaushalte und die
Unternehmenspleiten. Um nur ein Beispiel zu
nennen: Die fremdfinanzierten Übernahmen
von Unternehmen (LBO, Leveraged Buy Out)) schlagen
mit ca. 60 Mrd. bei den französischen Banken
zu Buche, wovon ein Gutteil sich in Luft aufzulösen
droht. In der Euro-Zone hinken die Banken im
Vergleich zu den USA mit den Wertberichtigungen
ihrer Bilanzen hinterher (Grafik 2). Eine Reihe
europäischer Länder sind quasi vom
Konkurs bedroht – sei es öffentlich
(Währung und Budget) oder privat (Banken
der neuen Mitgliedsstaaten).
| Grafik
2: Anstieg der erfolgten oder fälligen
Wertberichtigungen durch die Banken |
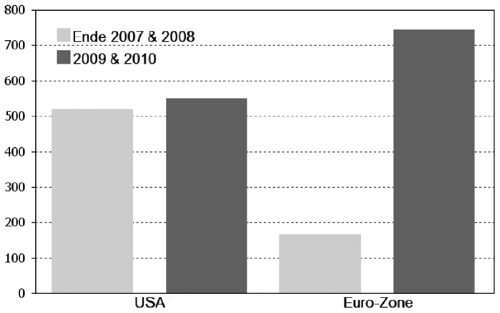 |
In
Mrd. Dollar
Quelle: Guillaume Duval, „Les banques
restent toujours fragiles“, Alternatives
Economiques n°283, September 2009, http://gesd.free.fr/fragibk.pdf |
Das
zweite Risiko liegt im Rückfall der Banken
in altes Spekulationsgebaren und der Entstehung
neuer Blasen. Martin Wolf, der renommierte Chronist
der Financial Times schreibt unumwunden, dass
das Finanzsystem, das zurzeit aus der Krise
hervorgeht, „noch schlimmer ist als jenes,
das sie hervorgebracht hat“.5
Die Bankinstitute, die die Krise überlebt
haben, „bilden ein Oligopol von Finanzungeheuern,
die zu groß und zu sehr miteinander verflochten
sind, um unterzugehen. Und sie haben sich durchgesetzt
(…), weil nämlich ihnen die umfangreichsten
Unterstützungen zuteil wurden. Man kann
sich unschwer vorstellen, wie sie sich verhalten
werden angesichts all der Vorrichtungen, die
zum vabanque-Spiel förmlich einladen.“
Die
Scheinregulierungen werden ganz offensichtlich
kaum ausreichen, derlei Exzesse zu verhindern:
„Genauso gut könnte man sich damit
beschäftigen, die Liegestühle auf
dem Deck der Titanic auszurichten – völliger
Humbug also“, warnt Martin Wolf spöttisch,
um dann doch schärfer zu werden: „Wenn
man zulässt, dass die Finanzinstitute nach
den Interessen von Aktionären, die nur
3 % der Kreditsummen beitragen, geführt
werden, ist dies schlichter Wahnsinn. Und noch
schwachsinniger ist es, die Interessen der Banker
an denen der Aktionäre ausrichten zu wollen.
Die großen Finanzinstitute mit ihrer gegenwärtigen
kapitalistischen Struktur laden geradezu ein,
mit dem Geld der Steuerzahler zu pokern.“
Diese
schonungslose Analyse soll die beiden Haupthindernisse
für effektive Regulierungsmaßnahmen
des Finanzsystems benennen. Zunächst einmal
würde dies ein breites Einvernehmen zwischen
den Großmächten voraussetzen, dem
sich die USA und England ganz offenkundig verschließen.
So versteht man auch das scheinheilige Gehabe
von Nicolas Sarkozy und Angela Merkel, die scheinbar
ihre Forderungen hochhalten, wohl wissend, dass
diese niemals durchsetzbar sein werden. Mit
den Bankern das gleiche Schauspiel: Man würde
gern ihre Bonuszahlungen beschränken, aber
wenn es die Anderen nicht tun, laufen uns die
besten „Köpfe“ weg.
Daneben
gibt es aber ein weiteres, eher technisches
Problem, das Martin Wolf so benennt: „Wenn
man in bedeutsamen Umfang Quoten für saubere
Fonds durchsetzen will, würde man die wirtschaftliche
Erholung gefährden.“ Wir stehen also
vor folgendem Dilemma: Reguliert man sofort,
riskiert man das System zu blockieren; entscheidet
man sich für einen „langfristigen
Übergang“ – wie Wolf vorschlägt
– hieße dies, die Regulierung auf
den Sankt Nimmerleinstag zu verschieben.
Die
Zentralbanken stecken mutatis mutandis in einer
ähnlichen Zwickmühle. Einerseits waren
sie gezwungen, haufenweise liquide Mittel in
die Wirtschaft zu pumpen, um sie überhaupt
am Laufen zu halten – und insofern ist
das Risiko einer Depression für den Moment
gebannt. Andererseits aber nähren sie damit
die nächste Blase, weil diese liquiden
Mittel absehbar wieder für spekulative
Zwecke auf dem Rohstoffsektor oder beim Emissionshandel
verwandt werden.6
Das Dilemma lautet daher: entweder den Zufluss
offen lassen, auch wenn dadurch eine neue Blase
droht, oder ihn zu begrenzen mit dem Risiko,
den Wiederaufschwung zu blockieren. Für
Jean-Claude Trichet, den EZB-Präsidenten,
liegt „die größte Gefahr“
in der Versuchung, allzu viel Hoffnung in die
zaghaften Anzeichen eines Wiederaufschwungs
seit diesem Frühjahr zu setzen und voreilig
die Strategien zum Austritt aus der Krise umzusetzen,
nämlich „die Liquidität zu drosseln,
die Zinsen wieder anzuheben und die Haushalte
zu kürzen“.7
Da
die Sachwalter in den kapitalistischen Institutionen
vor Verstaatlichungen zurückgeschreckt
sind, mithilfe derer sie das Bankensystem hätten
kontrollieren können, stehen sie nun unter
riesigem Zeitdruck und Orientierungsproblemen.
De facto zerreißt es sie zwischen zwei
entgegen gesetzten Zielen: das System schnell
zu sanieren, aber dabei nicht das zarte Pflänzchen
der Konjunktur zu zertreten. Dieser Widerspruch
ist unlösbar und darin liegt bereits das
erste Element der künftigen chaotischen
Regulierung. Daneben gibt es weitere, strukturelle
Elemente.
Was
nicht mehr geht …
Einer
der wichtigsten Motoren der Weltwirtschaft war
seit mindestens zehn Jahren der private Konsum
in den USA. Er belief sich 2007 auf 15 % des
weltweiten BIP – gemessen in der paritätischen
Kaufkraft (9 826 Mrd. Dollar von insgesamt 65
490 Mrd. Dollar), was eine erhebliche Sogwirkung
auf die gesamte Weltwirtschaft ausübte.
Dieser
Konsumrausch, der auf einer steten Abnahme der
Sparquote und zunehmender Verschuldung basierte,
lässt sich nach der Krise nicht weiterführen.
Aber um die Finanzblase auf Normalmaß
zu bringen, bedarf es noch etlicher Zeit. Im
ersten Quartal 2009 lag die Summe der Finanztitel
noch beim Vierfachen des BIP – eine Quote,
die 1998 ganz zu Beginn der Internetblase erreicht
wurde. (Grafik 3) Diese „Normalisierung“
des Finanzsektors geht einher mit einem Wiederanstieg
der Sparquote, führt aber zu neuen Widersprüchen,
da geringerer Konsum beigegebenem Einkommen
auch ein weniger dynamisches Wachstum für
die Gesamtwirtschaft bedeutet.8
| Grafik
3: Finanztitel in Prozent des BIP in den
USA 1952 – 2009 |
 |
| Quelle
: Federal Reserve, Flow of Funds ; Bureau
of Economic Analysis |
Insofern
bedarf es einer Neuorientierung, deren Grundzüge
Lawrence Summers, der Wirtschaftsberater von
Obama, kürzlich auf einer Konferenz dargelegt
hat: „Die amerikanische Wirtschaft muss
künftig mehr export- und weniger konsumorientiert
sein, mehr auf Umweltschutz und weniger auf
fossile Energien bauen, auf Biotechnologie und
Software und weniger auf Finanztechniken setzen,
mehr auf die Mittelschichten achten und weniger
auf Einkommenssteigerungen, die nur einer verschwindend
kleinen Minderheit der Bevölkerung zugute
kommen.“9
Bis der Export den Konsum als Wachstumsmotor
ersetzen kann, muss er allerdings weltweit sein
altes Niveau erreichen, um entsprechende Absatzmärkte
zu schaffen. Dies setzt voraus, dass sich die
Änderungen im Wirtschaftswachstum in einer
ausreichenden Zahl von Ländern symmetrisch
vollziehen: Wenn also die USA ihr Außenhandelsdefizit
herunterfahren, werden „Länder wie
China und wahrscheinlich auch Deutschland und
Japan keine Überschüsse mehr erzielen
und ihr Wirtschaftswachstum nicht mehr auf Exporte
stützen können. Stattdessen werden
sie die Binnennachfrage nachhaltig und grundlegend
ankurbeln müssen.“10
Im Moment jedoch verträgt sich diese Strategie
der USA nicht mit der von etlichen Ländern.
Mit anderen Worten können die wichtigsten
Länder nicht alle gleichzeitig ihr Wirtschaftswachstum
aus dem Export ableiten, was in gleicher Weise
für Deutschland hinsichtlich Resteuropa
gilt.
Alternativ
dazu bestände die Möglichkeit, die
Wettbewerbsfähigkeit der US-Exporte durch
die Abwertung des Dollars zu verbessern. Dies
wiederum würde die Rezession besonders
der europäischen Wirtschaft verstärken.Kurzum
steht die gesamte Weltwirtschaft in ihrer jetzigen
Beschaffenheit zur Disposition. Der größte
Unsicherheitsfaktor liegt in der Kursentwicklung
des Dollars und in der Finanzierung des US-Defizits,
das wieder zunehmen wird, wenn die Wirtschaft
in den USA wieder wächst, durch die übrige
Welt. Umgekehrt würden durch eine Umorientierung
der chinesischen Wirtschaft die Handelsüberschüsse
zurückgehen, genau so jedoch die Importe,
die großteils durch die Exporte erst zustande
kommen. Zudem drückt der wachsende Bedarf
an Energieeinfuhren auf die Überschüsse
und sogar auf das Wirtschaftswachstum.11
Jenseits
aller Einigungsrhetorik ist Europa im Begriff,
als wirtschaftliche Einheit zu zerfallen. Dieser
Zerfallsprozess hatte bereits vor der Krise
begonnen und erreicht eine neue Qualität
durch das unterschiedliche Ausmaß, in
dem die EU-Länder von der Krise betroffen
sind, je nach Stellenwert des Finanz-, Immobilien-
oder Automobilsektors und ihrer Einbindung in
den Weltmarkt. Eine wirtschaftspolitische Koordination
liegt demnach außer Reichweite, zumal
die Union sich ohne Not der dafür notwendigen
Einrichtungen – abgestimmte Haushalts-,
Steuer- und Währungspolitik – beraubt
hat. Das Europa der freien Konkurrenz ist logischerweise
zur Kirchturmspolitik verdammt, und der Einigungsprozess
gerät zum Desaster. Dies lässt sich
auch nicht innerhalb einiger Monate ändern
und bedürfte einer Neuformierung von Grund
auf.
Die
Weiterentwicklung der Krise
Da
durch die Krise die bisherige Funktionsweise
des Kapitalismus in seinen Grundfesten erschüttert
worden ist – wie oben beschrieben –
kann auch der gegenwärtige Miniaufschwung
keineswegs als Vorbote einer Rückkehr zum
Status quo ante gedeutet werden. Es handelt
sich hierbei vielmehr um eine Übergangsphase
hin zu einer chaotischen Regulierung des Kapitalismus.
Die anzunehmende Weiterentwicklung lässt
sich anhand zweier zentraler Variablen zusammenfassen:
dem Wachstum und der Beschäftigung. (Grafik
4)
| Grafik
4: Von der Rezession zum „Ausstieg
aus der Krise“ |
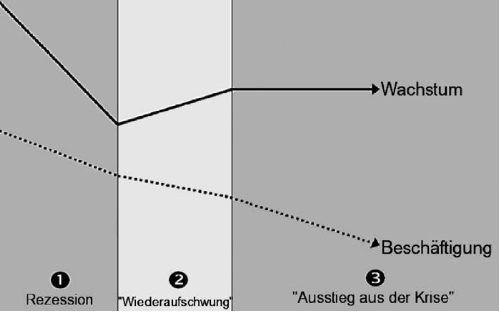 |
Die
Phase 1 – die Rezession – ist praktisch
beendet und wir befinden uns gegenwärtig
am Anfang der Phase 2 – des „Wiederaufschwungs“
(man beachte die Gänsefüsschen!).
Der
„Wiederaufschwung“ verdankt sich
gänzlich den diversen Konjunkturmaßnahmen
sowie einer relativen und vorläufigen Entschärfung
der Widersprüche der Weltwirtschaft. (Tabelle
1) Neben den Aspekten einer eher technischen
Erholung (Wiederherstellung der Vorratsbestände
und der Produktionskapazitäten) profitiert
die Konjunktur von den Fördermaßnahmen
und von „sozialen Stabilisatoren“.
Damit sind die (von den Neoliberalen verabscheuten)
Maßnahmen gemeint, die Entlassungen eindämmen
(Kurzarbeit) und die Kaufkraft der Haushalte
ergänzend stärken, um so einen noch
stärkeren Einbruch der Nachfrage zu verhindern.
Die Abschwächung der Wirtschaft hat daneben
zu einer Preissenkung der Rohstoffe geführt.
All diese Faktoren tragen zu einer wirtschaftlichen
Erholung bei und haben die Abwärtsbewegung
scheinbar erfolgreich gekippt und den Absturz
der Weltwirtschaft in die Depression verhindert.
(Tabelle 1)
Grafik
4: Von der Rezession zum „Ausstieg
aus der Krise“ |
|
Zugleich
kommen die strukturellen Widersprüche nicht
in vollem Umfang zum Tragen. Die Einkommensverteilung
entwickelt sich zu Gunsten der Lohnabhängigen
in dem Maß, wie die Beschäftigtenzahl
nicht in vollem Umfang an den Rückgang
der Produktion angepasst wird, wodurch wiederum
die Lohnstückkosten steigen. Die Sparquote
der Haushalte hat in den USA spürbar zugenommen
und mit zu einer Senkung des Handelsdefizits
geführt, während der Dollar vorübergehend
seine Talfahrt beendet hat. Zudem hält
sich die europäische Desintegration, d.
h. die wirtschaftspolitischen Divergenzen zwischen
den EU-Ländern, in Grenzen und die wechselseitigen
wirtschaftlichen Stimulationseffekte überwiegen.
Diese
verschiedenen Tendenzen werden immer mehr zu
Tage treten während der mutmaßlich
relativ kurzen Aufschwungphase (2-3 Quartale).
Die konjunkturbelebenden Faktoren werden sich
nach und nach erschöpfen, während
sich die grundlegenden Widersprüche verschärfen.
Die Exitphase aus der Krise wird demnach durch
all die o. g. ungelösten Probleme belastet
sein. Konkreter und unmittelbarer werden sich
die Schwierigkeiten, der Krise wirklich zu entkommen,
entlang zweier Kernprobleme bemerkbar machen,
nämlich der Rentabilität der Unternehmen
und der Haushaltsdefizite.
Profit
, Defizit und Wachstum – eine Gleichung,
die nicht aufgeht
Seit
vielen Jahren weisen die Profite unübersehbar
nach oben. Die Krise hat dem vorläufig
ein jähes Ende bereitet und zugleich die
Kapazitätsauslastung gesenkt. In jeder
Krise gibt es die zwei klassischen Mechanismen,
die zum Verständnis ihrer Weiterungen näherer
Betrachtung bedürfen.
Die
sinkende Rentabilität der Unternehmen lässt
sich darauf zurückführen, dass der
Anteil des Profits am Mehrwert zurückgeht
und die Ausnutzung der Produktionskapazitäten
rückläufig ist. Dieser Wert schwankt
normalerweise zwischen 80 – 85 % und ist
auf 70 % zurückgegangen. (Grafik 5) Mit
anderen Worten müssen die Unternehmen zu
viele Arbeitsstunden bezahlen und zuviel Kapital
gewinnbringend einsetzen, während die Produktion
zurückgeht.
| Grafik
5: Rate der Kapazitätsausnutzung und
Rentabilität der Unternehmen |
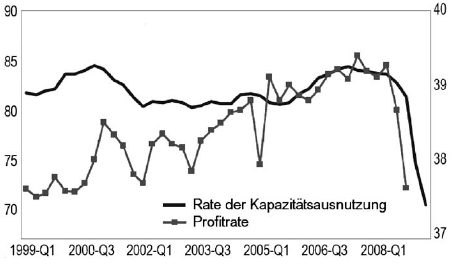 |
Der
Fall der Profitrate ist erheblich. Die im CAC
40 gelisteten Unternehmen haben im ersten Quartal
2009 im Vergleich zum Vorjahr einen Nettorückgang
um mehr als die Hälfte (56,4 %) erlebt.12
Dieser Rückgang lässt sich vorwiegend
auf die Entwicklung der Produktivität zurückführen.
Diese ist in der Tat erheblich gesunken –
in Frankreich um bis zu 2,5 % (Grafik 6) bei
ähnlicher Tendenz in den meisten anderen
Ländern. Daraus folgt, dass die Zahl der
Beschäftigten nur zum Teil an den Rückgang
der Produktion angepasst wurde. Dies wirkt sich
insofernpositiv aus, als dadurch der Rückgang
der Nachfrage gebremst wurde.
| Grafik
6: Wachstum der Produktivität pro Kopf
in Frankreich 1994 – 2009 |
 |
| Quelle:
Insee, comptes trimestriels |
Aber
durch den Konkurrenzdruck werden die Unternehmen
diesen Fall der Profitrate nicht lange hinnehmen
können und ihre Profite wieder herstellen
wollen – durch Entlassungen oder Lohnsenkungen.
Zugleich werden sich solche Instrumente wie
Kurzarbeit oder Abwrackprämie nach und
nach erschöpfen. Die dadurch entstehende
Arbeitslosigkeit und Lohnsenkung wird durch
die schrumpfende Kaufkraft der Haushalte die
Rezession anheizen. Und durch das geringe Wachstum
wird der Konflikt um die Verteilung von Lohn
und Profit weiter zunehmen, zumal auch noch
der Ölpreis durch diesen Miniaufschwung
in die Höhe gehen und durch Spekulation
noch weiter angeheizt wird.
Eine
sehr schöne Erklärung dafür findet
man bei Patrick Artus: „Wenn die Anforderungen
an die Kapitalrendite in den OECD-Ländern
so bleiben, wie sie vor der Krise waren, werden
die Unternehmen durch das anhaltend limitierte
Wachstum gezwungen sein, die Lohnkosten einschneidend
zu senken … mit den absehbaren sozialen
Folgen.“13
Dieser Widerspruch wird sich noch weiter zuspitzen,
wenn die neoliberale „Reform“politik
wieder Auftrieb erlangt. In einer Pressekonferenz
gab Jean-Claude Trichet vor kurzem glasklare
Empfehlungen in diesem Sinne ab: „Die
Bemühungen, das Wachstumspotential in der
Eurozone zu stützen, müssen immer
weiter intensiviert werden. (…) Es ist
unabdingbar, die fälligen Strukturreformen
anzupacken. Besonderes Augenmerk muss sich auf
die Reformen im Produktionssektor richten, um
die Konkurrenz hochzuhalten und zu schnelleren
Umstrukturierungen und Produktivitätssteigerungen
zu gelangen. Außerdem muss es durch entsprechende
Reformen des Arbeitsmarktes leichter gemacht
werden, Löhne festzusetzen und mehr Mobilität
der Arbeitskräfte zwischen den Branchen
und Regionen zu schaffen. Zugleich müssen
etliche der in den letzten Monaten verabschiedeten
Maßnahmen zur Stützung bestimmter
Wirtschaftszweige schrittweise und zu gegebener
Zeit wieder abgebaut werden. Der Schwerpunkt
muss ab jetzt eindeutig auf stärkere Anpassungsfähigkeit
und Flexibilisierung der Wirtschaft in der Euro-Zone
gesetzt werden – in Übereinstimmung
mit den Grundsätzen einer offenen Marktwirtschaft
unter den Bedingungen freier Konkurrenz.“14
Das
vorrangige Anliegen zahlreicher internationaler
Institutionen ist dabei, die unter dem Druck
der Krise ergriffenen Maßnahmen wieder
abzuschaffen. Eine Delegation des IWF äußerte
sich kürzlich über die Euro-Zone:
„Die Unterstützungsmaßnahmen
zur Kürzung der Arbeitszeit und zur Erhöhung
der sozialen Absicherung – so wichtig
sie gewesen sein mögen, um die Einkommen
zur erhöhen und die Arbeitskräfte
verfügbar zu halten – müssen
reversibel angelegt sein“.15
Für
weitere Spannungen sorgen die Auswirkungen der
Konjunkturpläne auf die Haushalte, in denen
sich dadurch erhebliche Defizite angehäuft
haben, die die Regierungen nun abzubauen bestrebt
sind, da sie sie für unvertretbar halten.
Erneut lassen wir Trichet zu Wort kommen: „der
strukturelle Anpassungsprozess muss auf alle
Fälle spätestens dann anfangen, wenn
die Wirtschaft wieder in Gang kommt. Die Aufwendungen
zur Sanierung müssen 2011 verstärkt
werden und deutlich oberhalb des Referenzwerts
von 0,5 % des BIP liegen, der im Pakt für
Stabilität und Wachstum dafür vorgesehen
ist. In den Ländern, in denen das Haushaltsdefizit
und/oder die öffentliche Schuldenquote
höher liegen, muss die jährliche strukturelle
Anpassung mindestens 1 % des BIP betragen.“16
Dafür
gibt es zwei Möglichkeiten: entweder die
öffentlichen Ausgaben senken oder die Steuern
erhöhen. Nach neoliberaler Manier wird
man eher die erste Option bevorzugen und in
erster Linie werden die Sozialausgaben im Visier
stehen. Aber zweifelsohne werden zusätzlich
noch die Steuern erhöht werden müssen,
was nochmals zu Lasten der breiten Masse und
nicht der Reichen gehen wird. In beiden Fällen
werden diese Maßnahmen einen neuen Nachfrageeinbruch
auslösen, was wiederum die Wirtschaftsdynamik
schwächt.
Vor
einer chaotischen Regulierung
Wir
können hier nicht den konkreten Verlauf
des Kapitalismus während der kommenden
Jahre vorhersagen, sondern lediglich die ganzen
Widersprüche auflisten, mit denen er konfrontiert
sein wird. Im Einzelnen handelt es sich um folgende
Dilemmata:
-
auf Ebene der Verteilung: Widerherstellung
der Rentabilität vs. Beschäftigung
und Nachfrage;
-
auf Ebene der Globalisierung: Abbau der
Ungleichgewichte vs. weltweites Wachstum;
-
auf Ebene der Haushalte: Abbau der Defizite
vs. Sozialausgaben;
-
auf europäischer Ebene: jeder für
sich vs. Koordination
Mit
dem Begriff der „chaotischen Regulierung“
wollen wir lediglich unterstreichen, dass man
sich kaum ein Modell vorstellen kann, das diese
Dilemmata kohärent lösen kann, und
dass dies sogar ausgeschlossen erscheint. In
der Theorie kann man einen „regulierten“
Kapitalismus wohl ins Auge fassen. Die Grundvoraussetzung
dafür wäre, dass er sich mit einer
niedrigeren Profitrate bescheidet gemessen an
der gegenwärtigen Rentabilitätsgier.
Eine andere Verteilung der Einkommen hätte
die Wiederaufwertung des Binnenmarktes zur Folge,
eine progressionsgewichtete Steuerreform und
grundlegend neue kooperativ geprägte Beziehungen
zwischen Nord und Süd und in der EU. Diese
Art von Neuausrichtung wird von nicht wenigen
Stimmen als realistisches Szenario gehandelt.
In
der Tat ist eine solche Regulierung nicht vorstellbar,
da die gegenwärtigen sozialen Kräfteverhältnisse
eine derartige Reform des Kapitalismus kaum
zuließen. Bestes Beispiel dafür ist
der – voraussichtlich erfolgreiche –
Widerstand innerhalb der Bourgeoisie gegen die
Gesundheitsreform der Regierung Obama. Im Übrigen
deutet alles darauf hin, dass die Regierungen
nur zu kosmetischen Maßnahmen aufgelegt
sind, die nur sehr begrenzte Bereiche der Finanzwirtschaft
umfassen und die wesentlichen Bereiche umso
besser bewahren. Ein Resultat der Krise wird
die Erkenntnis sein, wie sehr die Finanzwirtschaft
inzwischen weltweit die Regierungen dominiert.
Verstaatlichungen, die als einziges den jetzt
zusammengekrachten Schuldenberg hätten
bewältigen und das Finanzsystem auf klarer
Grundlage hätten sanieren können,
sind rundum abgelehnt worden. In Frankreich
symbolisiert der große Skandal dieses
Spätsommers – die eine Mrd. Euro,
die die BNP-Paribas an ihre Banker ausschüttet
– die aktuelle Entwicklung weltweit: die
Banken finden zu ihren alten Profiten zurück
und an den Börsen geht es wieder –
wenn auch verhalten – bergauf.
Es
sieht ganz danach aus, als hätten die Staaten
unter Inkaufnahme massiver öffentlicher
Verschuldung die Folgen des Ruins auf das System
aufgefangen. Und jetzt sollen im nächsten
Schritt diese Lasten auf die Steuerzahler und
die Sozialhaushalte abgewälzt werden. Nie
zuvor hat der Staat seinen Klassencharakter
so unumhüllt ans Licht gebracht.
Ebenso
vorstellbar wäre, dass die Unternehmen
ihre Profitmargen nur nach und nach wiederherzustellen
versuchten, was auch von ihrem Standpunkt gar
nicht so abwegig wäre, weil eine durch
Entlassungen und Lohnstop brachial wiederhergestellte
Profitrate durch den dadurch verursachten Nachfrageeinbruch
wieder zunichte gemacht würde. Aber eine
solche selbst aus kapitalistischer Sicht optimale
Lösung ist unerreichbar, da die kapitalistische
Konkurrenz regiert und diese durch den Neoliberalismus
aller Fesseln beraubt wurde. Es wird unter den
obwaltenden Bedingungen immer ein Unternehmen
oder ein Land geben, das auf rasche Anpassung
setzt und sich damit einen unmittelbaren Vorteil
gegenüber der Konkurrenz verschafft, die
ihrerseits dann nachzuziehen gezwungen wäre.
Zwischenstaatlich koordinierte Handhaben zur
Eindämmung dieses Phänomens existieren
nicht, weder auf europäischer und schon
gar nicht auf weltweiter Ebene.
Alles
was die Bourgeoisie heute anzubieten hat, ist
eine gigantische Scheinregulierung, die mit
großen Reden und trügerischen Gipfeltreffen
daherkommt. Für Patrick Artus gibt es keine
Anzeichen, „dass sich das Kräfteverhältnis
zwischen Aktionären und Lohnabhängigen
geändert hätte; oder dass langfristig
orientierte Investoren nennenswert vorhanden
seien, die nicht um kurzfristige Gewinne konkurrieren;
oder dass es weniger Investoren gäbe, die
auf unmittelbare Spekulationsgewinne erpicht
seien.“ Und er folgert, dass ein „Kapitalismus,
der nicht finanzorientiert sondern an langfristigen
Investitionen in nachhaltige Projekte interessiert
ist und in dem die Unternehmen entlang der Interessen
verschiedenster Gruppen und nicht bloß
der Aktionäre geführt werden, in weiter
Ferne liegt.17
Artus zeigt sich sogar schockiert „über
den wahllosen Rückgriff der Investoren
auf die alten Anlagenobjekte (Kredite, neue
Märkte, Rohstoffe, Devisenspekulation,
zyklische und Finanzwerte), sobald die Abneigung
gegen das Risiko zurückgegangen ist und
bloß ein paar Anzeichen der wirtschaftlichen
Besserung auftauchen.“18
Es
zeugt daher nicht von übermäßigem
Pessimismus, sondern von bloßer Hellsichtigkeit,
wenn man das Schlimmste noch vor sich sieht.
Der Kapitalismus ist in einer Sackgasse gefangen,
aus der er nur heraus kommt, wenn er die erforderlichen
Sozialabbaumaßnahmen noch forciert, um
die bestehende Gesellschaftsordnung zu wahren.
Die Auswirkungen der Krise sind bereits katastrophal,
besonders was die Länder des Südens
an-geht. In ihrem letzten Bericht über
die Entwicklungsziele des Milleniumgipfels betont
die UNO, dass „die Wirtschafts- und Ernährungskrisen
die jüngsten Fortschritte bei der Ausrottung
von Hungersnot und Armut wieder zunichte zu
machen drohen“.19
Aber
über diese unmittelbaren Folgen der Krise
hinaus werden die herrschenden Klassen alles
daran setzen, dass der Kapitalismus wieder so
funktioniert wie vor Ausbruch der Krise. Dies
klingt logisch und absurd zugleich; denn dieser
Weg ist auf immer verbaut, weil durch die Finanzkrise
die elementaren Voraussetzungen zerstört
worden sind. Darin liegt der Hauptwiderspruch
der vor uns liegenden Zeit, und insofern ist
es legitim, von einer chaotischen Regulierung
zu sprechen.
 |
| Michel
Husson |
Rückkehr
zum Wachstum ?
Seit
Mitte der 90er Jahre wurde das Wachstum durch
die zunehmende Verschuldung und die Globalisierung
forciert. Dieses zusätzliche Wachstum ist
nach den Berechnungen von Patrick Artus durch
die Krise verschwunden: „Das weltweite
BIP verliert mit der Krise alles, was es durch
die Kredite und Globalisierung gewonnen hat“.20
Man kann die Ausnahmestellung dieser Krise auch
so beschreiben. Historisch betrachtet haben
die Globalisierung und die Ausrichtung auf die
Finanzwirtschaft es ermöglicht, die Auswirkungen
der ungelösten Widersprüche des Kapitalismus
zu vertagen. Die Rezession von 1974/75 wurde
nur notdürftig und unter Inkaufnahme von
Rückschritten gelöst und damit bloß
verschoben. In gewisser Weise steht das System
wieder am früheren Ausgangspunkt, mit dem
Unterschied, dass es seine Munition inzwischen
verpulvert hat. Insofern steckt es in einer
Sackgasse, weil es gar keine andere Wahl hat,
als auf die alten Muster zurückzugreifen,
die bereits zu der großen Krise geführt
haben.
Die
Logik des Kapitalismus erzwingt weiteres Wachstum
um jeden Preis und muss sich daher an diesem
Kriterium messen lassen, wenn man seine Funktionstüchtigkeit
prüfen will. Zugleich will er aber das
erreichte, außergewöhnliche hohe
Rentabilitätsniveau beibehalten und setzt
sich damit ein unerreichbares Ziel. Die Wiedererlangung
des Wachstums ist unvereinbar mit der gegenwärtigen
Verteilung der Einkommen, die die Voraussetzung
für die hohen Profite ist, aber zugleich
das Wachstum bremst.
Dies
legt die Frage nahe, ob sich damit nicht automatisch
ein reformistisches Programm aufdrängt,
wonach der Kapitalismus quasi als Kompromiss
eine für die Lohnabhängigen bessere
Verteilung im Gegenzug für ein beständiges
Wachstum zugesteht und dabei die Finanzgewinne
auf Durchschnittsmaß drosselt. Derlei
Absicht unterstellt und Denis Collin, wenn er
schreibt: „Die Theorie der mangelnden
Nachfrage ist unter den Linken weit verbreitet.
Selbst die Radikalen wie Alain Bihr und Michel
Husson sind der Meinung, dass die Krise auf
der ungleichgewichtigen Verteilung von Mehrwert
und Lohn zulasten des letzteren beruht. Wenn
man also kurzum die Forderungen der ArbeiterInnen
nach Mehrung der Kaufkraft befriedigt und die
Reichtümer verteilt, könne man sehen,
wie die Wirtschaft wieder ins Laufen käme.“21
Diese Herangehensweise verkürzt das Problem,
weil es eine der grundlegendsten Dimensionen
dieser Krise außer Acht lässt, dass
nämlich der Kapitalismus außerstande
ist, eine hohe Rentabilitätsrate mit der
Befriedigung elementarer gesellschaftlicher
Bedürfnisse in eins zu bringen. Die vorherrschende
Verteilung der Einkommen wird nach Profitkriterien
bestimmt, was bedeutet, dass die Nachfrage seitens
der Lohnabhängigen nicht mehr angemessen
ist, weil sich daraus keine rentablen Absatzmärkte
mehr eröffnen, wie dies noch zu Zeiten
des „Fordismus“ der Fall gewesen
ist, als definitionsgemäß noch ein
relatives Gleichgewicht zwischen gesellschaftlicher
Nachfrage und Renditeerwartung bestand.
Unsere
Kritik zielt nicht auf einen nostalgischen Appell
zur Rückbesinnung auf das fordistische
Wachstumsmodell, da wir dies im Gegenteil für
obsolet halten, eben weil die gesellschaftliche
Nachfrage (unter den gegebenen Bedingungen)
nicht erzieltwerden kann. Unsere Kritik zielt
auf andere Inhalte, nämlich dass die Befriedigung
sozialer Bedürfnisse prioritär sein
muss, auch wenn dabei „rentable Investitionsmöglichkeiten“
außen vor bleiben. Konkret heißt
dies: Vorrang für öffentliche Dienste
und soziale Sicherheit, die die Sicherstellung
der Grundrechte auf Wohnung, Gesundheit etc.
gewährleistet, und Vorrang für die
Verkürzung der Arbeitszeit und damit für
die garantierte Vollbeschäftigung. Derlei
Perspektiven bedeuten nicht automatisch zusätzliches
Wachstum sondern vielmehr ein qualitativ anderes
Wachstum. Zugleich setzen sie in der Tat eine
radikal andere Verteilung der Einkommen voraus.
Eine derartige Neuausrichtung muss Hand in Hand
gehen mit dem realistischen Ziel, den Klimawandel
effektiv zu stoppen. Aus all diesen Gründen
unterscheiden sich unsere Vorstellungen grundlegend
von der Absicht, „die Maschinerie wieder
nach alter Manier ins Laufen“ bringen
zu wollen. Mit anderen Worten verläuft
die Suche nach einem sozial und ökologisch
vertretbaren Ausweg aus der Krise über
den Fortschritt des Antikapitalismus.
1
Rexecode, Les tendances de l’emploi en
France et en Europe à la mi -2009, Juli
2009, http://gesd.free.fr/rexecod9.pdf
zurück
2
Michel Husson, „Business as usual ?“,
Regards,
März 2009, http://hussonet.free.fr/basusual.pdf
zurück
3 Zu den jüngsten
Konjunkturdaten siehe: Quelles
sont les perspectives économiques pour
les
pays de l’OCDE ? Une évaluation
intérimaire,
OECD, 3 September 2009, http://gesd.free.fr/ocdint9.pdf
zurück
4
OCDE, Perspectives économiques : une
évaluation
intérimaire, 2009, s.Fn. 3.
zurück
5 Martin
Wolf, „Contrer la récidive bancaire“,
Le
Monde, 1. September 2009, http://gesd.free.fr/wolf1909.pdf
zurück
6
Rachel Morris, „Could Cap and Trade Cause
Another Market Meltdown?“ , Mother Jones,
8. Juni 2009, http://gesd.free.fr/rm9.pdf
zurück
7
Jean-Claude
Trichet, Pressekonferenz vom
2..Juli 2009, http://tinyurl.com/trichet79
zurück
8
S.
hierzu die detaillierte Darstellung von: Michel
Husson, „Chine-USA : les lendemains incertains
de la crise“, Nouveaux Cahiers Socialistes
n°2, Montréal, September 2009, http://hussonet.
free.fr/chimeri.pdf
zurück
9
Lawrence H. Summers, Rescuing and Rebuilding
the US Economy: A Progress Report,
17. Juli 2009, http://tinyurl.com/lsexpor
zurück
10
Fred Bergsten and Arvind Subramanian,
„America Cannot Resolve Global Imbalances
on Its Own“ , Financial Times, 19. August,
2009, http://tinyurl.com/bergft9
zurück
11
Siehe Minqi Li, „Peak Energy and the Limits
to China’s Economic Growth“, Political
Economy Research Institute Working Paper,
November 2008, http://tinyurl.com/minqili8
zurück
12
Le
Monde, 2. September 2009, http://gesd.
free.fr/cac4091.pdf
zurück
13
Patrick
Artus, „S’il n’y a pas baisse
de l’exigence
de rentabilité du capital, la situation
sociale va devenir très tendue aux Etats-
Unis, en Europe, au Japon“, Flash Natixis
n°397, September 2009, http://gesd.
free.fr/flas9397.pdf
zurück
14
Jean-Claude
Trichet, s. o. Fußn. 7.
zurück
15
IWF, Déclaration de la mission du FMI
sur les
politiques mises en oeuvre dans la zone euro,
8.
Juni 2009, http://tinyurl.com/fmieuro9
zurück
16
Jean-Claude
Trichet, s. o. Fußn. 7.
zurück
17
Patrick
Artus, „Disparition du „capitalisme
fi-
nancier“ après la crise ?“
Flash Natixis n°376,
28. August 2009, http://gesd.free.fr/flas9376.pdf
zurück
18
Patrick Artus, „Le chien de Pavlov et
les investisseurs“,
Special report n°253, Natixis, September
2009, http://gesd.free.fr/flar9253.pdf
zurück
19
UNO,
Rapport 2009 sur les Objectifs du Millénaire,
http://tinyurl.com/onumill9
zurück
20
Patrick Artus, „Reste-t-il quelque chose
du
supplément de croissance dû à
la mondialisation
et au crédit?“, Flash Natixis n°395,
September 2009, http://gesd.free.fr/flas9395.pdf
zurück
21
„Faut-il consommer plus ?“, Le Sarkophage,
Juli 2009, http://tinyurl.com/collin09
zurück
|