| Dennoch
zeigen diese extremen Spannungen, dass die Krise
drei Jahre nach Ausbruch noch lange nicht beigelegt
ist und die Rechnung dafür, die zuerst
auf die öffentlichen Haushalte abgewälzt
wurde, nun der Bevölkerung serviert wird.
In diesem Beitrag soll Bilanz gezogen werden
über die jüngsten Entwicklungen im
Kapitalismus, um dann die Folgen für die
durch die Krise eröffnete Phase zu untersuchen.
…
und die Profitrate steigt
Dabei
scheint doch alles zum Besten zu stehen, wenn
man den Profit zum Maßstab des Kapitalismus
nimmt. Die Gewinnspanne, mit anderen Worten
der Anteil der Profite am Mehrwert, erholt sich.
In den Vereinigten Staaten, wo sie zuerst eingebrochen
war,1 liegt sie heute beinahe wieder
auf dem Niveau von vor der Krise. In der Euro-Zone
kam der Einbruch später und die Erholung
erfolgt langsamer: die Gewinnspanne befindet
sich heute auf dem Wert von vor zehn Jahren,
womit die Steigerung des letzten Jahrzehnts
zumindest vorläufig dahin ist (Grafik 1).
Doch die Profite weisen in Richtung Anstieg.
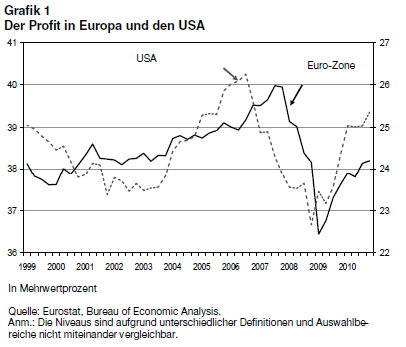
Übrigens ist das einer der auffälligsten
Züge der Konjunktur: Während überall
Sparprogramme beschlossen werden, die Arbeitslosigkeit
auf hohem Niveau verharrt und die Löhne
eingefroren sind oder sinken, galt die Hauptsorge
der großen Unternehmensgruppen und Banken
der erneuten Ausschüttung von Dividenden
und Boni.
Das
Wachstum zeigt dagegen ganz andere Ergebnisse.
Man muss sich damit abfinden: Auch das Wachstum
des BIP ist ein nützlicher Indikator zur
Beurteilung der Gesundheit des Kapitalismus
(nicht zu verwechseln mit Wohlstand). Selbst
wenn letztlich die Profitrate das entscheidende
Kriterium ist, kann diese sich nach der Krise
kaum langfristig erholen, wenn sich keine Absatzmöglichkeiten
auftun. Aus dieser Sicht war die große
Frage, ob die Rezessionsdelle überwunden
würde. Auf den ersten Blick waren drei
Szenarien denkbar: das Aufholen der Tendenz
vor der Krise, anhaltende Verluste oder sogar
steigende Verluste.
Die
neuesten verfügbaren Daten zeigen, dass
die meisten Länder anhaltende Verluste
ausweisen.2 Im ersten Quartal 2011
liegt das BIP mancher Länder noch unter
dem Niveau von vor der Krise, etwa in Japan,
Großbritannien, Spanien und Italien. Die
USA, Deutschland und Schweden erreichen knapp
dieses Niveau und Frankreich ist nicht mehr
weit davon entfernt. Betrachtet man die Konjunktur
unter diesen Gesichtspunkten, lassen sich ein
paar allgemeine Trends erkennen.
Europa
bricht auseinander. Während Frankreich,
Schweden und Deutschland die Delle überwunden
haben, gilt das für viele andere EU-Länder
wie Spanien, Griechenland, Irland, Italien,
Portugal und Großbritannien nicht, die
dauerhaft abgehängt wurden oder Mühe
mit der Wiederankurbelung der Wirtschaft haben.
Die
alten kapitalistischen Länder hinken hinterher.
Die USA haben vorläufig zum Wachstumsrhythmus
zurückgefunden, den sie vor der Krise hatten.
Die Europäische Union als Ganzes tut sich
schwerer und hat das Loch noch nicht gestopft.
Japan ist weit davon entfernt, sein BIP befindet
sich seit der Atomkatastrophe wieder im Sinken.
Dagegen befinden sich die beiden aufstrebenden
Märkte (China und Indien) weiterhin im
Aufschwung und wurden von der Krise kaum erfasst.
Andere, wie Brasilien, Korea und Russland, haben
einen stärkeren Einbruch erlebt.
Die
Arbeitslosigkeit setzt sich fest. Die
Vereinigten Staaten und Europa zeigen dasselbe
Bild. Obwohl das Wachstum wieder anzieht, sinkt
die mit der Krise gestiegene Arbeitslosenrate
nicht wieder. (Grafik 2)
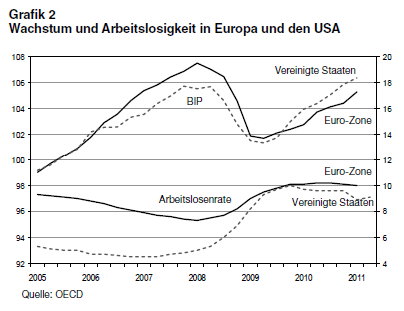
Die
Rechnung ist noch nicht beglichen.
Offenbar lassen sich die Wachstumseinbrüche
also nicht auffangen. Selbst wenn die Vereinigten
Staaten und Europa wieder zu ihrem früheren
Wachstumsrhythmus zurückfänden, könnten
die „Gewinnausfälle“ also nicht
mehr aufgefangen werden. Deren Höhe lässt
sich durch Vergleich zwischen den effektiven
BIP und dem Wert ermitteln, den das BIP ausweisen
würde, wenn sich der Vorkrisentrend fortgesetzt
hätte. Die Differenz beträgt rund
8 Prozent in der Euro- Zone und 6 Prozent in
den USA. Das BIP der USA beträgt rund 15
000 Mrd. Dollar, jenes der Euro-Zone rund 9400
Mrd. Euro bzw. 12 000 Mrd. Dollar. In beiden
Fällen liegen die Gewinnausfälle also
bei rund 900 Mrd. Dollar (750 Mrd. Euro).
Diese
BIP-Ausfälle äußern sich in
der steigenden Verschuldung der öffentlichen
Hand. In der Euro-Zone ist diese zwischen 2008
und 2010 um 980 Mrd. Dollar gestiegen. In den
USA ist sie in derselben Periode noch stärker
gestiegen, nämlich um 3200 Mrd. Dollar.
Verkürzt
lässt sich festhalten: Der „BIP-Verlust“
drohte den Schuldenberg zum Einsturz zu bringen.
Zur Schadensbegrenzung haben die Staaten Gewinnausfälle
auf sich genommen. Nun stellt sich die Frage,
wie sie mit diesen Schulden umgehen sollen,
wobei natürlich versucht wird, die breite
Mehrheit der Bevölkerung zur Kasse zu bitten.
Dieser Plan stößt jedoch auf diverse
Probleme, und diese Ungewissheit wird noch lange
spürbar bleiben und macht eine Rückkehr
zum früheren Wachstum noch unwahrscheinlicher.
Wenn nichts geschieht, um diese Schulden infrage
zu stellen, könnte sich der Abbau des Schuldenbergs
genauso lange hinziehen, wie er entstanden ist.
Das Wachstum wäre in dem Maße gebremst,
wie es vor der Krise künstlich belebt wurde.
Daneben spricht etwas Grundlegenderes dafür,
dass das Wachstum in den beiden bedeutenden
Polen der kapitalistischen Wirtschaft dauerhaft
schwächer bleiben wird: Das US-Modell kann
nicht mehr wie bisher funktionieren, und die
Euro-Zone ist in eine dauerhafte strukturelle
Krise gerutscht.
Grenzen
des US-Modells
Die
ganze Logik des US-Modells wird aus Grafik 3
ersichtlich, die erklärt, warum das Modell
an seine Grenzen stößt. In der Grafik
werden zwei Kurven miteinander verglichen: Die
erste ist die Sparquote der privaten Haushalte
(in Prozent ihres verfügbaren Einkommens).
Sie ist seit Beginn der 1980er- Jahre bis zum
Ausbruch der Krise tendenziell gesunken. Während
der ganzen Zeit (ein Vierteljahrhundert) haben
die durchschnittlichen Haushalte also einen
steigenden Anteil ihres Einkommens aufgebraucht.
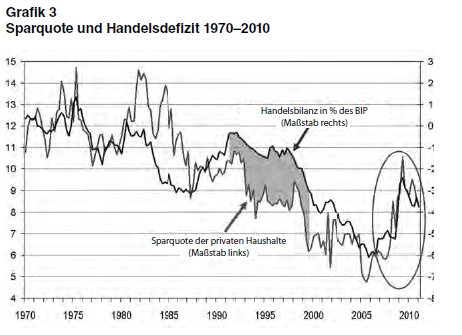
Für
diese sehr markante Entwicklung gibt es außerhalb
der Vereinigten Staaten nichts Vergleichbares.
Sie entspricht zweierlei Mechanismen, die von
den verschiedenen sozialen Kategorien unterschiedlich
in Anspruch genommen wurden. Erstens dem Reichtumseffekt:
Da mein Finanz- oder Immobilienvermögen
an Wert zunimmt, muss ich weniger sparen und
kann gemessen an meinem Einkommen mehr konsumieren.
Und zweitens der Überverschuldung: Mein
Einkommen stagniert, aber ich verschulde mich,
um weiterhin konsumieren zu können. Manche
einkommensstarken Haushalte verschuldeten sich
übrigens, um an der Börse zu spekulieren.
Dieses Phänomen hat stark zum BIP-Wachstum
beigetragen, das durch den Mehrkonsum angetrieben
wurde.3 Doch nicht jedes beliebige
Land hätte ein solches Modell übernehmen
können. Es führt zu einer negativen
Handelsbilanz, wie in der zweiten Kurve zu erkennen
ist.
Die
durch den Konsum der Haushalte belebte Binnennachfrage
steigt tendenziell rascher als die nationale
Produktion. Die Differenz wird durch erhöhte
Importe ausgeglichen, die das Handelsdefizit
vergrößern. Das Modell war nur funktionsfähig,
solange die Finanzierung dieses Defizits der
restlichen Welt aufgehalst werden konnte. Deshalb
verlaufen die beiden Kurven (Sparquote und Handelsdefizit)
der Grafik für die gesamte Periode 1980–
2006 mehr oder weniger parallel.
Diese
Korrelation ist kein Zufall, sondern ergibt
sich aus einer wesentlichen Rechnungsgleichung,
die man „Ausgleichsregel“4
nennen könnte und die wie folgt lautet:
Private Ersparnis + Haushaltssaldo = Handelsbilanzsaldo.
Die
private Ersparnis entspricht der kumulierten
Ersparnisse von Unternehmen und Privathaushalten.
Erstere sind im Normallfall negativ (die Unternehmen
verschulden sich), letztere positiv (insgesamt
sparen die Privathaushalte mehr, als sie sich
verschulden), doch die Summe aus beiden kann
positiv oder negativ ausfallen.
Dagegen
ist die der Haushaltssaldo im Allgemeinen defizitär.
Die Gleichung drückt die Tatsache aus,
dass der Handelsbilanzsaldo der Summe aus privater
Ersparnis und Haushaltssaldo entspricht. Fällt
sie negativ aus, bedeutet das, dass das Zahlungsbilanzgleichgewicht
durch Kapitalimporte gewährleistet wird.
Mit anderen Worten ist es die restliche Welt,
die den Sparbedarf des entsprechenden Landes
deckt. Im Fall eines Handelsbilanzüberschusses
tritt das Gegenteil ein: Das Land (Staat + Haushalte
+ Unternehmen) weist einen Überschuss an
Ersparnis aus, den es in Form von Kapitalausfuhr
im Austausch gegen seinen Handelsbilanzüberschuss
exportieren kann.
Folglich
gehen die sinkenden Sparquoten der US-Haushalte
natürlich mit einer Erhöhung der Handelsbilanz
einher. Die anderen zu berücksichtigenden
Faktoren (Unternehmensverschuldung und Budgetdefizit)
spielen dagegen eher eine zweitrangige Rolle.
Dennoch sind sie in Grafik 3 ebenfalls ersichtlich.
Während der 90er-Jahre ist eine sinkende
Sparquote der Haushalte zu beobachten, das Handelsbilanzdefizit
stabilisiert sich aber tendenziell. Dafür
gibt es einen einfachen Grund: Im Verlauf dieser
Periode hat sich die Haushaltsbilanz erheblich
verbessert. Es ist von einem Defizit von -5
Prozent des BIP im Jahr 1992 auf einen Überschuss
von 2,6 Prozent im Jahr 2000 gestiegen, bevor
es mit dem Platzen der Internetblase, Bushs
Steuergeschenken und den Militärausgaben
erneut nach unten ging. Mit der Krise und Konjunkturprogrammen
sinkt es noch weitere in den Abgrund: Heute
liegt das Budgetdefizit in einer Größenordnung
von 10 Prozent des BIP.
Dieses
buchhalterische Verhältnis bestätigt
sich immer, doch das sagt noch nichts darüber
aus, wie genau das geschieht. Es gibt keinen
Faktor, dem sich die übrigen anpassen;
jeder reagiert nachträglich auf die anderen.
Am wichtigsten ist jedoch, dass der Ausgleich
unvereinbar ist mit jeglicher Wachstumsrate.
Im Fall der USA kann dieses Gleichgewicht nur
um den Preis einer Wachstumsrate erzielt werden,
die niedriger ist als vor der Krise.
Dennoch
lassen sich (ebenfalls in Grafik 3) Anzeichen
eines positiven Zyklus in der jüngsten
Periode feststellen. Nach Einsetzen der Krise
hat die Sparquote der Privathaushalte zu sinken
aufgehört und sogar um 4 BIPPunkte zugelegt.
Das hatte unmittelbare Auswirkungen auf die
Handelsbilanz im gleichen Umfang. Auf den ersten
Blick handelt es sich um eine gute Entwicklung,
da dies bedeutet, dass die Wirtschaft der Vereinigten
Staaten weniger stark auf ausländisches
Kapital zurückgreifen muss. Doch ergibt
sich folgender Widerspruch: Da die sinkende
Sparquote in den Vereinigten Staaten das Wachstum
angekurbelt hat, bedeutet ihr Wiederanstieg,
dass nicht mehr auf diese Unterstützung
gesetzt werden kann.
Ebenfalls
in Betracht zu ziehen ist das wachsende Budgetdefizit,
das so hoch ist wie nie im letzten Jahrhundert
(ca. 10 Prozent des BIP). Kein Wunder, dass
die Budgetpolitik heute einer der zentralen
Konfliktpunkte zwischen Demokraten und Republikanern
ist. Hier tut sich ein neuer Widerspruch auf:
Der Sparbedarf, ob vom Privatsektor oder dem
öffentlichen Defizit ausgehend, wird immer
schwerer von den Kapitaleinnahmen gedeckt werden
können.
Auch
hier liegt die Rentabilitätsschwelle bei
einem niedrigeren Wachstumsniveau, mit den damit
verbundenen politischen und sozialen Problemen,
insbesondere durch die ebenfalls historisch
hohe Arbeitslosenrate, die zwischen März
und Juni von 8,8 auf 9,2 Prozent gestiegen ist.
Rechnet man die entmutigten Erwerbslosen und
die Teilzeitbeschäftigten auf Suche nach
einem Vollzeitjob hinzu, ist heute jeder sechste
Arbeiter von Arbeitslosigkeit betroffen.
Es
gibt nur zwei Möglichkeiten, wie dieses
angespannte System gelockert werden könnte.
Die erste bestünde darin, das US-Exportwachstum
zu fördern, was ein zusätzliches Wachstum
ohne Vertiefung des Handelsdefizits erlauben
würde. Dieses Ziel könnte durch Investitions-
und Innovationsbemühungen erreicht werden,
doch in der gegenwärtigen Konjunktur sind
die Investitionen wenig dynamisch und die transnationalen
Unternehmen ziehen wenn schon, dann Auslandsinvestitionen
vor. So bleibt nur die kontinuierliche Abwertung
des Dollars, die die US-Erzeugnisse wettbewerbsfähiger
machen würde. Doch diese Tendenz könnte
an ihre Grenzen stoßen, Zweifel am Dollar-Kurs
wecken und zu einer Verknappung nötiger
externer Finanzmittel führen, um die Defizite
zu decken. Dieser Weg ist also mit grundlegenden
Unsicherheiten behaftet.
Eine
andere Lösung könnte in einer substanziellen
Änderung der Einkommensverteilung liegen.
Seit Anfang der 1980er-Jahre wurden die wachstumsbedingten
Mehreinnahmen von einem sehr begrenzten Bevölkerungsteil
in Anspruch genommen. Zwischen 1982 und 2007
stieg das Durchschnittseinkommen um 18 900 Dollar.
Doch diesen Einkommenszuwachs haben sich die
reichsten 10 Prozent zu 81 Prozent angeeignet.5
So
wäre auch ein geringeres Wachstum annehmbar,
wenn es besser verteilt wäre, so dass die
Löhne wie die Produktivität der Arbeit
ansteigen würden. Unmittelbar würde
eine radikale Steuerreform den Abbau des Defizits
erlauben, indem die Nutznießer dieses
Vierteljahrhunderts der Ungerechtigkeit zur
Kasse gebeten würden. Offenkundig lässt
sich eine solche Lösung mit dem gesellschaftlichen
Kräfteverhältnis jedoch nicht durchsetzen.
Unter diesen Umständen werden die Vereinigten
Staaten vermutlich versuchen, gegenüber
dem Rest der Welt den Fortbestand ihres Wohlstands
durchzusetzen. Doch auch das ist nicht möglich,
denn es kollidiert mit dem Rückgang des
Kapitals, das bereit wäre, das Auslandsdefizit
der Vereinigten Staaten zu finanzieren. In China
und einem guten Teil der aufstrebenden Märkte
werden sich die Überschüsse übrigens
auch in dem Maß reduzieren, wie deren
Ökonomien sich auf die eigenen Binnenmärkte
konzentrieren und sich der Handel dieser Länder
untereinander intensivieren wird.
Die
Krise bürgerlicher Ordnungspolitik in Europa
Von
der Krise hätten eigentlich Kapitalismuskritiker
politisch profitieren müssen. Die Wirklichkeit
sieht leider anders aus: Die radikale Linke
kann sich nicht wirklich verbreitern, die Sozialdemokratie
und die Rechte wechseln sich in Wahlen ab, während
die nationalistische Rechte rundum punktet.
Die Ursachen dafür hängen mit dem
systemischen Charakter der Krise zusammen, zu
der sich in Europa noch die spezifischen Widersprüche
des unfertigen Aufbaus [der europäischen
Einheit] gesellen. Man kann hier von Bumerangeffekt
des neoliberalen Aufbaus Europas und des Entscheids
zur Einheitswährung sprechen. Diese wurde
im Wesentlichen als Mittel der Lohndisziplin
entwickelt. Da nicht mehr mit Wechselkursen
gespielt werden kann, wurden die Löhne
die einzige Anpassungsvariable, um mehrere nationale
Ökonomien in ein und derselben Währungszone
zusammenzuführen. Doch dieses System ist
inkohärent und enthält zwei Ausweichvariablen.
Wer Einheitswährung sagt, sagt nominale
Konvergenz der Zinssätze, im vorliegenden
Fall nach unten. Das führte zum perversen
Effekt, dass ein Land, das seine Preise schlecht
in den Griff bekommt, von einem real noch schlechteren
Zinssatz profitiert, was die Entwicklung eines
auf Verschuldung gründenden Wachstums fördert.
Zudem verschwindet mit der Einheitswährung
per definitionem der rückwirkende Effekt
des Handelsdefizits auf die Währung eines
Landes. Spanien hat von diesen beiden Auswirkungen
profitiert und ein starkes Wachstum verzeichnet,
das zu einem spektakulären Rückgang
der Arbeitslosigkeit führte. Doch dieses
Wachstum stützte sich auf einen unkontrollierten
Immobilienboom und ein beeindruckendes Handelsdefizit.
All
das konnte mehr recht als schlecht funktionieren,
doch mit der Krise wurden die Unstimmigkeiten
des neoliberalen europäischen Modells offenkundig.
Europa befindet sich jenseits der tagtäglichen
Handwerkelei an einem Scheideweg: Entweder es
tut einen Schritt in Richtung Föderalismus,
der unmittelbar erlaubt, die Schulden gemeinsam
zu tragen, oder die Euro- Zone bricht auseinander.
Da die europäischen Bourgeoisien nicht
bereit sind, die eine oder die andere Lösung
auf sich zu nehmen, bedeutet dies eine ausgesprochen
schwere Krise. Noch dazu kann von einer vereinten
europäischen Bourgeoisie nicht wirklich
gesprochen werden, da es weder ein europäisches
Kapital noch einen europäischen Staat gibt.
Es
gilt der Einfachheit halber zwischen vier „Akteuren“
zu unterscheiden: den großen transnationalen
Unternehmensgruppen, den Banken, der Finanz
und den Regierungsvertretern der herrschenden
Klassen. In einer Reihe von Fragen besteht unter
diesen weitgehend Einigkeit, wenn es um wesentliche
Klasseninteressen geht. In der gegenwärtigen
Konjunktur besteht die gemeinsame Perspektive
darin, die Situation umzukehren und die Krise
für eine Schocktherapie zu nutzen. Die
Krise bietet die Gelegenheit, im Sozialabbau
noch weiter zu gehen: durch Abbau der öffentlichen
Ausgaben, Einfrieren der Löhne, Rentengegenreformen
etc.
Doch
die Interessengemeinschaft schützt nicht
vor inneren Widersprüchen, die durch die
Krise zugespitzt werden. Sie können anhand
von zwei Achsen analysiert werden, in denen
sich einerseits die Staaten und die Kapitalien
und andererseits die Finanz und andere kapitalistische
Fraktionen gegenüberstehen. Die gegenwärtige
Lage ist aus Sicht der herrschenden Klassen
geprägt durch die wachsende Unfähigkeit,
die Widersprüche in den Griff zu kriegen.
Die
Krise der Staatsverschuldung verrät den
ersten Widerspruch. Das Kapital kümmert
sich im Allgemeinen nicht mehr um die Konjunktur
im einen oder anderen Land, da seine wichtigste
Sorge seiner Rentabilität und seinen Marktanteilen
gilt. Doch weder die Absatzmärkte noch
die Produktionsketten binden die transnationalen
Gruppen an ein bestimmtes Territorium, selbst
wenn sie sich im Fall von Schwierigkeiten an
ihren Bezugsstaat wenden. Im globalisierten
Kapitalismus reduziert sich die Rolle des Staates
immer mehr darauf, allgemeine Rentabilitätsbedingungen
zu gewährleisten. Carlos Ghosn, CEO von
Renault, kann etwa in der Financial Times (2.
Juni 2010) erklären, dass „Renault
kein französischer Autobauer mehr ist“,
schwächt seine Aussage aber gleich ab,
indem er daran erinnert, dass „Renault
französisch ist und seine Basis in Frankreich
hat“ (Europe 1, 13. Juni 2010).6
Und tatsächlich ist es der französische
Staat, der seinen Autobauern die nötigen
Mittel vorgestreckt hat, als sie sich in einer
schwierigen Lage befanden. Wir befinden uns
nicht mehr im globalen Kapitalismus, wie ihn
vor nahezu einem Jahrhundert Bucharin7
beschrieben hat, als es noch möglich war,
Staaten und Kapitalien miteinander in Deckung
zu bringen.
Die
große Neuerung besteht darin, dass die
transnationalen Gruppen eine globale Ausrichtung
haben und sich nicht mehr auf den nationalen
oder auch europäischen Rahmen beschränken.
Bucharin sprach noch von einer „höhere[n]
Stufe des Protektionismus“, den er in
der „staatlichen Formel für die Wirtschaftspolitik
der Kartelle“ sah. Die Dinge haben sich
gewandelt, und man kann ihm nicht vorhalten,
die Veränderungen des Kapitalismus nicht
vorausgesehen zu haben. Ähnliches gilt
für die Verteidiger der „Entglobalisierung“,
die einen Handelsprotektionismus vorschlagen,
als gäbe es die Globalisierung in der Produktion
nicht. Diese neue Lage schafft eine tiefe Asymmetrie:
Die Staaten sind im Dienst „ihrer“
Kapitalien, doch diese sind befreit von der
Notwendigkeit eines dynamischen Binnenmarkts.
Derweil müssen die Staaten trotzdem weiterhin
die Klassenverhältnisse im Inneren jedes
Landes managen. Insbesondere kommt ihnen heute
die Verantwortung dafür zu, ihren Bürgern
die Kosten der Krise aufzuhalsen.
Ein
zweiter Widerspruch besteht zwischen der Finanzwelt,
den Banken und den Staaten. Er tritt heute besonders
stark zutage, da die Finanz gegen die Staatsverschuldung
spekuliert und damit die Banken indirekt in
den Konkurs zu ziehen droht, da diese einen
großen Teil dieser Schulden halten. Die
Abgrenzungen zwischen den drei Akteuren (Banken,
Finanz, Staaten) sind natürlich fließend
und ausgesprochen undurchsichtig. Dennoch sind
es gerade diese Interessenkonflikte, die zur
extrem instabilen Lage beitragen. Die Diskussionen,
die innerhalb der europäischen Bourgeoisien
stattfinden, zeigen diese tiefe Krise der bürgerlichen
Herrschaft, die von der Befürchtung, wenn
nicht Panik, herrühren, welche Auswirkungen
es hätte, sollte Griechenland seine Schulden
nicht mehr bedienen können. Die Regierungen
fahren auf Sicht, mit zwei Zielen: Ihrer Bevölkerung
die Rechnung für die Krise zu servieren
und gleichzeitig den Konkurs ihrer Banken zu
verhindern. Dabei gehen sie ein doppeltes Risiko
ein: Durch den unvermeidlichen Ausfall der griechischen
Schulden drohen den Banken Verluste, die sie
im Übrigen nur schlecht abschätzen
können. Ein guter Teil der Ökonomen
in den Banken arbeiten heute mit realistischeren
Stresstests als den offiziellen Simulationen,
die bestenfalls Unterhaltungswert haben. Die
Ergebnisse sind so beunruhigend, dass zahlreiche
Banken beschlossen haben, den Schock vorwegzunehmen,
indem sie eine kontrollierte Umschuldung der
griechischen Schulden bis zur nächsten
Fälligkeit akzeptiert haben. Doch ein anderer,
von der EZB vertretener Standpunkt lehnt ein
solches Vorgehen strikt ab. Die EZB befürchtet,
dass dieses Modell auf andere geschwächte
Länder für noch viel umfangreichere
Kredite als die griechischen ausgeweitet wird.
Die dogmatische Haltung soll vor allem helfen,
Zeit zu gewinnen, um „die Finanzmärkte
zu beruhigen“, in der Hoffnung, die Lage
in den gefährdeten Ländern würde
sich beruhigen.
Sicher
ist jedenfalls, dass niemand auch nur einen
Augenblick daran glaubt, dass Griechenland seine
Schulden bedienen kann. Das betont auch der
Kommentator von Bloomberg:8 „Selbst
wenn Griechenland einen neuen Rettungsplan erhalten
und sich seine Wirtschaft wieder beleben würde,
müsste die Regierung mindestens drei Jahrzehnte
lang einen Primärüberschuss –
außerhalb des Schuldendienstes –
von 5 Prozent des BIP herausholen, um die Schulden
auf höchstens 60 Prozent des BIP zu senken,
wie dies die Regeln der Euro-Zone vorschreiben.
Ein solches steuerliches Husarenstück ist
ausgesprochen selten, selbst auf fünf Jahre
hin, und das gilt erst recht für Griechenland.“9
Der jüngste Rettungsplan ändert nur
am Rande etwas an dieser Feststellung.
Die
sozialdemokratische Sackgasse
Zumindest
vorübergehend hat die Krise sozialdemokratischen
Ansätzen wie dem Keynesianismus, der Regulierung
von Finanz, Banken und dem Kapitalismus insgesamt,
der Rückkehr staatlicher Interventionen,
der Rolle des Sozialstaats bei der Dämpfung
der Rezession, der Forderung nach gerechterer
Verteilung von Einkommen und Steuern etc. einen
neuen Auftrieb verliehen. Die Krise schien die
Sozialdemokratie zu begünstigen, und so
ist es wichtig zu verstehen, warum sich ihr
politischer Spielraum nicht erweitert, sondern
verengt hat.
Diskutieren
kann nur, wer zuhört, und der französische
Präsident ist bestens in der Lage, quasi-globalisierungskritische
Vorschläge aufzugreifen. Dem müssen
Taten folgen, und das ist nicht unbedingt der
Fall. Die europäische Sozialdemokratie
war und ist ebenfalls einem Stresstest unterworfen,
den sie nicht gut bestanden hat. Ein Musterbeispiel
dafür ist der sozialistische griechische
Regierungschef Papandreou, der ein absolut klägliches
Krisenmanagement an den Tag legt. Er hätte
sich hart geben und sagen können: „Griechenland
kann nicht zahlen, also muss man diskutieren.“
So hat das Argentinien gemacht, als es 2001
die Bedienung des Schuldendienstes aussetzte
und eine Neuverhandlung seiner Schulden durchsetzen
konnte. Doch Papandreou hat buchstäblich
gekuscht und diskussionslos alle Forderungen
der „Troika“ (EZB, IWF, EU) akzeptiert.
Papandreou
ist kein Einzelfall. Dasselbe gilt beispielsweise
für Zapatero und die europäischen
Abgeordneten, die mit den Grünen und den
Liberalen einen Bericht der sozialistischen
französischen Abgeordneten Pervenche Berès
angenommen haben.10 Unter den darin
enthaltenen Empfehlungen findet sich diese Auswahl:
Der Bericht fordert „Maßnahmen zur
Überwindung der zurzeit mangelnden Wettbewerbsfähigkeit
durch Strukturreformen“, „begrüßt
den Grundsatz eines europäischen Semesters
der Koordination der Wirtschaftspolitik“
und „unterstreicht die Notwendigkeit der
Öffnung der öffentlichen Märkte
auf einer transparenten, gegenseitigen Grundlage“.
Man
müsste den ganzen Wortlaut zitieren. So
heißt es etwa: „der Steuerwettbewerb
ist in dem Maß akzeptabel, als er die
Fähigkeit der Mitgliedstaaten nicht beeinträchtigt,
Steuern einzunehmen, die sie vernünftigerweise
zu Recht erwarten können, und erinnert
daran, dass Lösungen gefunden werden müssen,
um den schädlichen Steuerwettbewerb möglichst
zu verringern.“ Dieses neue Konzept des
schädlichen Steuerwettbewerbs wird zweifellos
in die Geschichte eingehen.
Das
insbesondere für Frauen bestehende Armutsrisiko
wird zwar erwähnt, doch die Schlussfolgerung
ist seltsamerweise ein Aufruf an die „bestehenden
Nichtregierungsorganisationen“. Angesichts
der Einsparungen im Sozialbudget beschränkt
sich der Bericht auf die Aussage, „es
könne auch wünschenswert sein, die
Dienstleistungen im öffentlichen Sektor
zu schützen und folglich das bestehende
Maß an sozialer Absicherung beizubehalten“,
selbst wenn es natürlich „nötig
ist, den öffentlichen Finanzhaushalt zu
konsolidieren“. Der Konjunktiv („könnte
wünschenswert sein“) sagt alles.
Obwohl ein paar spannende Ansätze enthalten
sind, sind diese mit einer berührenden
Ängstlichkeit vorgebracht. So übt
der Bericht beispielsweise fürchterlichen
Druck auf die Kommission aus, von der er fordert,
sie „solle über ein zukünftiges
System von Euro-Obligationen („Euro-Bonds“)
nachdenken“.
In
Frankreich haben sich die beiden wichtigsten
SP-Kandidaten hinter das Sparprogramm gestellt.
François Hollande tut dies sehr klar:
„Wir müssen bis 2013 eine ausgeglichene
öffentliche Rechnung erreichen. (…)
Ich sage das nicht, um irgendeinem Druck der
Märkte oder der Rating-Agenturen nachzugeben,
sondern weil es die Voraussetzung dafür
ist, dass unser Land wieder zu Selbstvertrauen
zurückfindet.“ Martine Aubry folgt
seinem Beispiel und verpflichtete sich ebenfalls
auf die „3 Prozent bis 2013 (…),
denn das ist heute die Regel.“11
Diese
fürchterliche Formulierung („denn
das ist heute die Regel“) ist vielsagend
und liefert den Schlüssel zur vertrackten
Lage, in der sich die Sozialdemokratie befindet.
Zusammengefasst könnte man sagen, jedes
authentisch sozialdemokratische Programm würde
ein höheres Maß an Konfrontation
mit der Bourgeoisie erfordern, wozu die Sozialdemokratie
nicht bereit ist.
Angesichts
der Krise kann die Wirtschafts- und Sozialpolitik
nicht im stillen Kämmerchen auf der Grundlage
von Modellen und Theorien ausgeheckt werden.
So gibt es beispielsweise eine sogenannte postkeynesianische
Schule12, dass eine arbeitnehmerfreundliche
Einkommensverteilung, verbunden mit einer eingeschränkteren
Aktionärsmacht positive Auswirkungen auf
das Wachstum und die Beschäftigung haben
würde. Auch wenn diese Beiträge nützlich
sind, um auf die Ursachen der gegenwärtigen
Krise zu verweisen, unterschätzen sie doch
deren systemischen Charakter. Insbesondere berücksichtigen
sie nicht, dass die wachsenden sozialen Bedürfnisse
und die Kriterien des Kapitalismus, auch wenn
er sich der Finanz entledigen würde, immer
mehr auseinanderklaffen.
Die
momentane Realität sieht so aus, dass jeder
fortschrittliche Krisenausgang eine direkte
Konfrontation mit der Logik des Kapitals erforderlich
machen würde und damit eine hohe Konfliktbereitschaft.
Die erwähnten Beispiele zeigen im Grunde,
dass die sozialdemokratischen Programme unter
einem Mindestmaß an Radikalität,
das sie verweigern, sich nur marginal von der
neoliberalen Logik unterscheiden.
Verbaute
Perspektiven
Jede
Rezession erzeugt Spannungen und Widersprüche,
die sich in der Steuerung der Wirtschaftspolitik
zeigen, die wieder an das Wachstum anknüpfen
will. Das gilt insbesondere für die jüngste
„große Rezession“, doch diese
ist auch ein Symptom einer systemischen Krise:
Der Kapitalismus kann nicht mehr funktionieren
wie bisher. Eine Rückkehr zum Business
as usual oder zum regulierten Kapitalismus des
Wirtschaftswunders nach dem Weltkrieg ist nicht
möglich.
Die
durch die Krise eröffnete Phase zeichnet
sich somit durch weitreichende Unsicherheiten
aus. Der Kapitalismus sucht einen Ausweg auf
seine Weise, ist damit aber mit folgenden Hindernissen
konfrontiert, die ich in einem früheren
Artikel als Dilemmata bezeichnet habe.13
1.
das Verteilungsdilemma: Die Wiederherstellung
des Profits steht im Widerspruch zum erneuten
Aufschwung des Wachstums und verbindet sich
tendenziell mit einer ungleichen Reichtumsverteilung,
die jedoch selbst eine der tieferen Ursachen
der Krise ist.
2.
das Budgetdilemma: Die Auflösung
der öffentlichen Defizite setzt einen Abbau
der öffentlichen Ausgaben voraus, der abgesehen
von den sozialen Folgen die rezessiven Tendenzen
zur verschlimmern kann. „Die Sparprogramme
drohen den Wideraufschwung noch weiter hinauszuzögern“,
heißt es in einem kürzlich erschienenen
Bericht der UNO.14
3.
das europäische Dilemma: Angesichts
des dreifachen Neins – zur gemeinsamen
Übernahme der öffentlichen Schulden,
zu einem realen Beitrag der Banken und zur Ordnungspolitik
für die Finanz – ist ein Auseinanderbrechen
der Euro-Zone durch eine Kette von Ausfällen
nicht ausgeschlossen.
4.
das Globalisierungsdilemma: Die Ungleichgewichte
können nur aufgelöst werden, wenn
das weltweite Wachstum abgeschwächt wird.
Der bereits zitierte UNO-Bericht hält fest,
dass „der weltweite Wiederaufschwung durch
die hochindustrialisierten Ökonomien gebremst
wurde“, und betont das Risiko eines „nicht
koordinierten Ausgleichs der Weltwirtschaft“.
Die
vier Dilemmata hängen eng miteinander zusammen.
Sie zeichnen eine „chaotische Regulierung“
des Kapitalismus, der dauerhaft unfähig
ist, einen Ausweg aus der Krise zu weisen, der
mit den zutiefst widersprüchlichen Interessen
vereinbar wäre. Nur soziale Mobilisierungen
können verhindern, dass der Kapitalismus
versucht, aus der Krise zu kommen, indem er
noch weiter Sozialabbau betreibt und die Spannungen
zwischen Ländern aufs Schlimmste anheizt.
Das setzt aber voraus, dass sich diese Mobilisierungen
an Alternativen orientieren können. Da
diese ein hohes Maß an Konfrontation bedeuten,
besteht die historische Aufgabe heute darin,
die Einheit der Kräfte der radikalen Linken
rund um ein Programm zu erreichen, das eine
Verbindung zwischen Widerstand gegen die Sparpolitik
und Zielen des Bruchs mit der Logik eines in
Schieflage geratenen Systems herstellt.
Aus
Inprecor, 28. Juli 2011, Übersetzung: tigrib
1
Siehe „La baisse de la profitabilité
des entreprises a précédé
la crise financière“,
note hussonet Nr. 8, September 2009.
2
Detaillierter in: „Pertes de PIB et facture
de crise“, note hussonet Nr.°35, Juli
2011.
3
Für eine detailliertere Analyse des USModells,
siehe Michel Husson, “Etats-Unis :
lafin d’un modèle„, La Brèche
Nr.°3, 2008 und “Chine–USA.
Les lendemains incertains de
la crise„, Nouveaux Cahiers Socialistes
Nr. 2, Montreal, 2009.
4 Siehe „Les limites (comptables) du modèle
US“, note hussonet Nr.°36, Juli 2011.
5
Quelle: When Incomes Grows, Who gains?, Economic
Policy Institute.
6
Zitiert nach Claude Jacquin in einem beachtenswerten
Artikel: „Crise industrielle
: de quoi parle-t-on ?“, Les Temps Nouveaux
Nr.°3, 2011.
7 Nikolai Bucharin, Imperialismus und Weltwirtschaft,
1917.
8
Bloomberg, 29. Juni 2011.
9 Siehe „Pertes de PIB et facture de crise“,
note hussonet Nr. 35, Juli 2011.
10
Rapport sur la crise financière, économique
et sociale: recommandations concernant les
mesures et initiatives à prendre.
11
Laurent Mauduit, „Adieu Keynes! Vive Raymond
Barre!“, Mediapart, 19. Juli 2011.
12 Da sie auf der Linie von Autoren wie Michal
Kalecki, Joan Robinson und Luigi Pasinetti
liegt.
13
Michel Husson, „La nouvelle phase de la
crise“, ContreTemps Nr.°9, 2011.
14
Situation et perspectives de l’économie
mondiale, UNO, 2011. Die Zitate sind der
französischen Zusammenfasung des Berichts
entnommen. |