 |
Antiglobalisierung |
 |
ArbeiterInnenbewegung |
 |
Bildungspolitik |
 |
Frauenbewegung |
 |
Geschichte |
 |
Imperialismus
& Krieg |
 |
International |
 |
Kanton
Zürich |
 |
Marxismus |
 |
Umweltpolitik |
 |
Startseite |
 |
Über
uns |
 |
Agenda |
 |
Zeitung |
 |
Literatur |
 |
Links |
 |
Kontakt |
| Schwerpunke
/ Kampagnen |
 |
Bilaterale
II |
|
|
|
Der
Kapitalismus in der Krise
Michel
Husson - aus Inprekorr Nr. 444/445 - November/Dezember
2008
Download
als pdf |
| Die
gegenwärtige Krise erschüttert den
neoliberalen Kapitalismus in seinen Grundfesten.
Sie verläuft sprunghaft und niemand kann
vorhersehen, wohin sie führen wird. Der
folgende Beitrag soll nicht dazu dienen, den
Verlauf zu rekonstruieren, zumal dies zum Zeitpunkt
der Veröffentlichung vermutlich schon überholt
wäre . Er soll vielmehr zum Verständnis
der Grundlagen beitragen und die sozialen Folgen
dieser Krise aufzeigen. |
Die
Funktionsweise der Finanzkrise
Die
Finanzkrise mag wegen ihrer Komplexität
auf Anhieb verwirren, aber trotzdem lassen
sich die grundlegenden Mechanismen herausarbeiten.
Ausgangspunkt ist das Vorhandensein riesiger
Mengen „überschüssigen”
Kapitals auf der Suche nach maximaler Rendite.
In regelmäßigen Abständen
erschließt sich dieses Kapital neue
lukrative Märkte und löst eine Anlageeuphorie
aus, die nach dem Prinzip der Self-Fulfilling
Prophecy funktioniert: Indem es sich auf den
vermeintlich profitabelsten Sektor stürzt,
treibt es dort den Preis nach oben und rechtfertigt
somit die Anfangseuphorie. Die Warnungen derer,
die darauf verweisen, dass die Finanzmärkte
nicht in den Himmel wachsen können, werden
abgetan, da ja alles reibungslos verläuft.
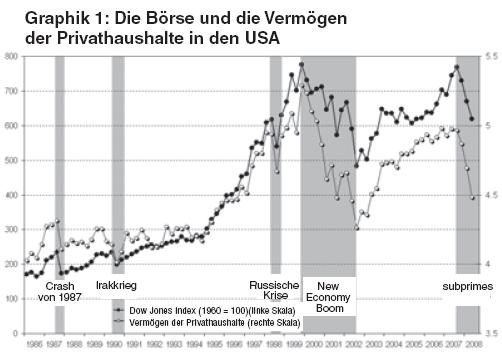
Graphik
1 gibt eine Übersicht über die zeitlichen
Eckdaten: Die Börsencrashs 1987 und 1990
am Vorabend des Ersten Golfkriegs; der Boom
der New Economy ab Mitte der 90er Jahre, der
zu einem wahren Börsenrausch führt;
die Krise in Südostasien und Russland
sowie die Pleite des US-Hedgefonds LTCM bringen
1998 die Blase nur vorübergehend zum
Abschwellen und erst 2000 kommt es zum richtigen
Börsenbeben; zwei Jahre später dann
die erneute Flucht nach vorn und schließlich
die Subprime-Krise im Juli 2007.
Damit
eine Spekulationsblase entstehen kann, reicht
es nicht aus, dass bloß die Geldmengen
verfügbar sind, sondern es dürfen
auch keine Regulationsmechanismen im Wege
stehen. Diese Reglementierung wurde durch
politische Maßnahmen und durch immer
ausgefeiltere Finanzinstrumente und undurchsichtige
Transaktionen ausgehebelt. Beispiel hierfür
ist die Hebelwirkung der Derivate, mit deren
Hilfe die Finanzinstitute über ein Vielfaches
ihres eigenen Kapitals verfügen. Über
Derivate können beispielsweise zukünftige
Kaufs- und Verkaufsrechte erworben werden.
Und ihrer faulen Kredite können sich
die Banken entledigen, indem sie sie zu einer
Art Überraschungspaket bündeln und
als handelbare Wertpapiere verbriefen. Diese
geraten dadurch in Umlauf, werden außerbilanziell
und unterliegen somit nicht mehr der Bankenaufsicht
zur Risikobegrenzung.
Die
Subprime-Krise hat ein relativ überschaubares
Marktsegment betroffen, nämlich die Hypothekendarlehen
an einkommensschwache Haushalte. In Wirklichkeit
waren diese Verträge Schwindel, weil
die Banken davon ausgehen konnten, dass die
Darlehen nicht zurückgezahlt würden.
Aber durch die Verbriefung und den Verkauf
der Ansprüche konnten sie sich ihrer
entledigen. Mit dem Umschwung auf dem Immobiliensektor
kamen die ersten Privatkonkurse: Ein Verkauf
der Häuser, auf denen die faulen Hypothekendarlehen
lasteten, war nicht mehr möglich oder
nur zu einem Preis, der noch unter dem Anfangskredit
lag. Die Immobilienkrise löste eine Kettenreaktion
aus: Eine Bank nach der anderen bemerkte ihre
Verluste und bekam zunehmende Probleme, neue
Finanzquellen zu erschließen, um diese
Verluste zu decken. Um zu verhindern, dass
sich die Banken gegenseitig mit in den Abgrund
reißen, pumpten die Regierungen und
Zentralbanken Geld in das System oder „verstaatlichten”
sie zum Teil.
Von
der Finanzsphäre zur Realwirtschaft
Aus
dem obigen Szenario ergeben sich mehrere Fragen,
besonders nach den Auswirkungen auf die Realwirtschaft.
Wie jede Finanzkrise muss auch die aktuelle
Krise als ein „Ordnungsruf” des
Wertgesetzes verstanden werden.
Jedes
Geldvermögen hat einen bestimmten Wert.
Wenn ich eine Million Aktien besitze, deren
Kurs bei 100 € liegt, beträgt mein
Reichtum 100 Millionen Euro. Wenn sich der
Kurs meiner Aktien verdoppelt, verdoppelt
sich auch mein Reichtum; wenn er um die Hälfte
sinkt, verliere ich 50 Millionen Euro. Diese
Zahlen spiegeln jedoch nur den fiktiven Wert
meines Geldvermögens wider. Die Gewinne
oder Verluste werden erst dann real, wenn
ich versuche meine Aktien zu veräußern,
um mir etwas Konkretes zu leisten, etwa ein
Haus. Die Börsenkapitalisierung, also
der Gesamtwert der Aktien an sich ist fiktiv.
Die Finanzmärkte sind vorwiegend Nebenmärkte,
auf denen man bspw. Vivendi-Aktien verkauft,
um France Télécom-Aktien zu
kaufen. Der Kurs dieser Aktien kann entlang
von Angebot und Nachfrage schwanken, aber
diese Transaktionen sind selbst genau so fiktiv
wie der Kurs, zu dem sie sich vollziehen.
Man könnte den Preis dafür auch
vertausendfachen, als wäre es eine besondere
Art von Geld, die mit dem richtigen nichts
zu tun hat. Genau so könnte man sich
ein Wirtschaftssystem vorstellen, in dem jeder
Mensch Aktienmilliardär wäre, vorausgesetzt
natürlich, er würde sie nicht verkaufen.
Wir hätten es also mit einer Realwirtschaft
zu tun, die ihren üblichen ruhigen Gang
geht, und mit einer Finanzsphäre, die
sich exponentiell aufbläht.
Aber
auf Dauer ist eine solche Divergenz nicht
vorstellbar, weil zwischen der Finanzsphäre
und der Realwirtschaft Umtauschbeziehungen
bestehen. Ein Wirtschaftswachstum von 2-3
% kann keine durchgängige Rendite von
15 % abwerfen, wie die Fondsgesellschaften
behaupten. Solange die Einkünfte aus
Geldvermögen wieder neu angelegt werden,
wachsen die Vermögen, ohne dass eine
materielle Bindung an die Realwirtschaft besteht,
und die Diskrepanz kann theoretisch bis ins
Unendliche wachsen. Aber wenn ein Teil der
Ziehungsrechte aus diesen Vermögenstiteln
in der Realwirtschaft kapitalisiert –
mit anderen Worten: in Waren umgetauscht –
werden soll, gilt zwangsläufig das Wertgesetz
mit den Regeln von Angebot und Nachfrage.
Angenommen, dass diese neu erworbene Kaufkraft
auf keine Entsprechung auf Seiten der Produktionssphäre
trifft und auch die Lohnforderungen nicht
aus der Welt schaffen kann, dann erfolgt die
Regulation über die Preise, was dazu
führt, dass die Einkommen, einschließlich
der Kapitaleinkünfte, entwertet werden.
Dies erklärt übrigens die starke
Anfälligkeit der Rentiers für eine
Inflation, da dadurch die tatsächlichen
Gewinne aus ihren Vermögen beeinflusst
werden. Wenn es zu einer solchen Entwertung
kommt, schlägt sich dies auf die Vermögenswerte
durch und die Kurse der Wertpapiere müssen
fallen, um sich den realen Gewinnen, die sie
erwirtschaften, wieder anzugleichen.
Die
Wertpapiere stellen einen Rechtsanspruch auf
den produzierten Mehrwert dar. Solange dieses
Recht nicht ausgeübt wird, bleibt alles
fiktiv. Sobald man es aber realisieren will,
stellt man fest, dass es dem Wertgesetz unterworfen
ist, das schlicht und einfach bedeutet, dass
nicht mehr verteilt werden kann, als erwirtschaftet
worden ist. Aus objektiver Sicht müssten
die Börsenkurse die vorweggenommenen
Gewinne der Unternehmen darstellen, von denen
aus Kapitaleinkünfte ausgeschüttet
werden können. Inzwischen haben sie aber
völlig abgehoben und stehen nur noch
in marginaler Beziehung zu den Kapitalrenditen,
die auf der Ausbeutung der menschlichen Arbeit
gründen. Nie zuvor in der Geschichte
des Kapitalismus hatte dieses Phänomen
solche Ausmaße erreicht, und nie war
es möglich, dass dies ewig andauert.
Die
ökonomische Basis der Finanzmärkte
Die
Finanzblasen beruhen nicht nur auf den Illusionen
raffgieriger Spekulanten sondern werden durch
die permanente Erzeugung überschüssigen
Kapitals genährt. Hauptquelle ist das
tendenzielle Wachstum nicht akkumulierter
(reinvestierter) Gewinne, das auf zwei Entwicklungen
basiert: einerseits dem generellen Absinken
der Löhne und andererseits der stagnierenden
oder gar rückläufigen Akkumulationsrate
trotz Wiederherstellung der Profitrate. Graphik
2 zeigt, dass Profitrate und Akkumulationsrate
(Nettoinvestition) bis Anfang der 80er Jahre
parallel und anschließend erheblich
auseinander liefen. Das grau schraffierte
Feld weist die Zunahme des nicht akkumulierten
Anteils am Mehrwert aus.
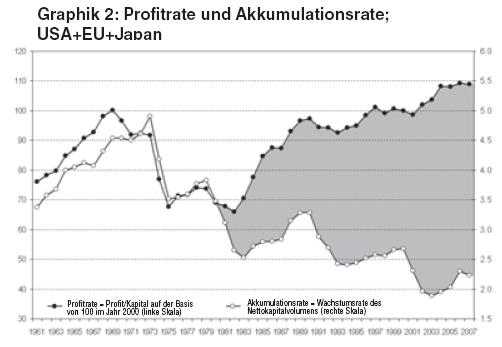
Diese
nie da gewesene Konstellation wirft a priori
die Frage auf, wer die Produkte kaufen wird,
wenn der Anteil der Löhne sinkt und die
Investitionen stagnieren. Mit anderen Worten:
Welches Reproduktionsschema wäre vereinbar
mit diesem neuen Modell? Darauf gibt es nur
eine Antwort: Der Konsum aus nicht Lohn-bezogenen
Einkünften muss den stagnierenden Konsum
der Lohnempfänger kompensieren. Und genau
dies passiert, wie Graphik 3 zeigt.
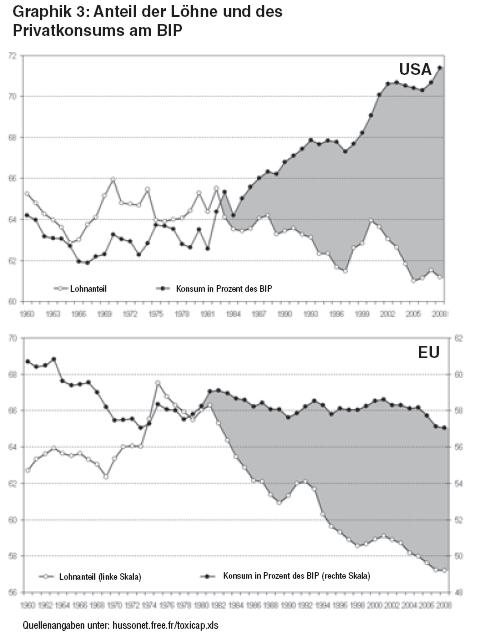
Hierauf
werden die Entwicklungen veranschaulicht:
In den USA bleibt der Anteil der Löhne
am BIP relativ konstant, aber der Konsum der
Haushalte nimmt viel schneller zu als das
BIP; in Europa bleibt das Verhältnis
von Konsum zum BIP ungefähr gleich, obwohl
der Anteil der Löhne zurückgeht.
In beiden Fällen nimmt die Schere zwischen
dem Anteil der Löhne und dem des Konsums
zu (graues Feld) und kompensiert das Auseinanderklaffen
von Profit und Akkumulation. Diese Kompensation
wird durch die Geldwirtschaft auf dreierlei
Wegen ermöglicht. Der erste ist der Konsum
der Rentiers: Ein Teil des nicht akkumulierten
Mehrwerts wird an die Bezieher von Kapitaleinkünften
verteilt, die ihn dann ausgeben. Dies ist
ein wichtiger Punkt, denn die Reproduktion
ist nur möglich, wenn der Konsum der
Rentiers den der Lohnabhängigen auffängt,
um den Absatz zu gewährleisten. Daraus
ergibt sich zwangsläufig ein Anwachsen
der Ungleichheit.
Der
zweite von der Finanzsphäre ausgehende
Effekt besteht in einer Verwischung der Grenzen
zwischen Löhnen und Kapitalrenditen:
Ein wachsender Einkommensbestandteil der Lohnabhängigen
erfolgt in Form von Entgelten, die sich eher
als Verteilung von Mehrwert denn als tatsächlicher
Lohn darstellen. Als letztes – und dies
trifft vorwiegend auf die USA zu – ermöglicht
die Geldwirtschaft eine galoppierende Verschuldung
der Haushalte, deren Konsum wächst, ohne
dass die Löhne steigen, aber die Sparquote
sinkt.
Der
Finanzsektor ist also kein Parasit an einem
gesunden Körper. Er lebt vom nicht reinvestierten
Profit, erlangt aber mit der Zeit ein Maß
an Unabhängigkeit, das den Mechanismus
weiter anheizt. Das überschüssige
Kapital zirkuliert auf der Suche nach höchstmöglicher
Rendite (die berühmten 15 %) und erzielt
sie auch – wenigstens vorübergehend
– in bestimmten Sektoren. Die Banken
streichen einen wachsenden Anteil der Gewinne
ein. Diese Konkurrenz um die Höchstrendite
hebt die Rentabilitätsnorm weiter an
und schmälert dadurch die als rentabel
erachteten Investitionsmöglichkeiten,
wodurch wiederum neues Kapital freigesetzt
wird, das sich seinerseits auf die Suche nach
Höchstrenditen in der Finanzsphäre
begibt. Dieser Teufelskreis beruht letztlich
auf einer Verschlechterung der Einkommensverteilung
der ArbeiterInnen und ihrer sozialen Absicherung.
Das
Überspringen auf die Realwirtschaft
1987
hatte der Börsencrash die meisten Wirtschaftswissenschaftler
zu der Prognose einer drastischen Weltwirtschaftskrise
verleitet. Das Gegenteil ist eingetroffen:
Ab 1988 erlebten die Metropolen einen dynamischen
Aufschwung. Die Börsenkrise hatte somit
die Realwirtschaft nicht erreicht, sondern
im Gegenteil für eine Bereinigung und
Anpassung gesorgt. Normalerweise besteht die
klassische Funktion einer Krise darin, die
Geschäftsfelder zu prüfen und die
lahmen Enten auszusortieren. Einige Jahre
später erlitt Japan, das damals als Anwärter
auf die Beherrschung der Weltmärkte gehandelt
wurde, eine Krise auf dem Immobilien- und
Hypothekensektor. Die Folge war eine zehn
Jahre lange Wirtschaftsstagnation, von der
sich das Land kaum erholt hat.
Der
Finanzsektor ist also mehr oder weniger und
je nach Ort und Zeit unabhängig, und
es stellt sich heute die Frage, ob die Finanzkrise
auf die Realwirtschaft überspringen wird.
Eine Theorie besagt, dass die gegenwärtige
Konjunkturabschwächung nicht in erster
Linie Folge der Finanzkrise, sondern durch
andere Faktoren bedingt sei: Anstieg der Erdöl-
und Rohstoffpreise, falsche haushalts- und
finanzpolitische Maßnahmen in Europa,
Konkurrenz der Schwellenländer etc. Die
Finanzkrise als solche treffe v. a. die USA
und habe relativ wenig Auswirkung auf die
Weltkonjunktur. Die Nachfrage aus den Schwellenländern
ersetze die USA, so lautet die so genannte
Entkopplungstheorie. Die Intervention der
Staaten und Zentralbanken verhindere eine
Kettenreaktion wie in der Großen Depression
1929 und strecke die Verluste der Banken zeitlich.
Kurzum: Die Finanz- und die Wirtschaftssphären
seien einigermaßen getrennt voneinander.
Diese
Analyse beruht auf unbestreitbaren Tatsachen,
zieht aber daraus nicht die Konsequenzen,
die ihrer optimistischen Grundhaltung zuwider
laufen. Es ist richtig, dass die Krise verschiedene
Dimensionen vereint, was besonders auf die
steigenden Erdöl- und Rohstoffpreise
zutrifft. Aber diese verschiedenen Aspekte
wirken zusammen und lassen sich letztlich
auf einen gemeinsamen Ausgangspunkt zurückführen,
nämlich die heutige Beschaffenheit der
Weltwirtschaft. Es dient nicht dem Verständnis
der gegenwärtigen Krise, wenn man meint,
sie in getrennte Bereiche unterteilen zu können.
Dieses zeitliche Zusammenfallen verstärkt
im Gegenteil das Übergreifen der Finanzkrise
auf die Realwirtschaft. Es lassen sich im
Wesentlichen sechs Verbindungskanäle
aufzeigen, die von Land zu Land unterschiedlich
schwer wiegen können:
-
Die Kreditklemme spielt eine wichtige Rolle
bei der Ausbreitung der Finanzkrise, da
die unter ihren Verlusten leidenden Banken
sich nicht refinanzieren können. Diese
Einschränkungen betreffen aber auch
das Konsumverhalten und die Investitionsneigung
der Unternehmen. Besonders ausgeprägt
wird dieser Effekt in den USA und Großbritannien
sein, wo der Konsum der Privathaushalte
auf Verschuldung beruht.
-
Die Börsenbaisse entwertet das Finanz-
und Immobilienvermögen der Haushalte
(s. Graphik 1) und bremst ihren Konsum.
Dies ist der so genannte Vermögenseffekt.
-
Die allgemeine Verunsicherung – der
„Vertrauensverlust” –
lastet auf Konsum- und Investitionsklima.
-
Die Immobilienkrise trägt als solche
zum allgemeinen Abflauen der Wirtschaftskonjunktur
bei.
-
Die erheblichen Summen, die für die
verschiedenen Rettungspakete ausgegeben
werden, haben einen Rückgang der öffentlichen
Ausgaben oder eine Steuererhöhung zur
Folge.
-
Die Konjunkturabschwächung erreicht
über Handel und Investitionen die gesamte
Weltwirtschaft.
All
diese Mechanismen sind gegenwärtig wirksam,
zusammen mit anderen Aspekten der Krise (Erdöl
etc.), und führen zu einer Ausweitung
über die Finanzsphäre hinaus. Insofern
gibt es keine hermetische Abschottung zwischen
Finanzwirtschaft und Realökonomie, da
schließlich der Finanzsektor ein Kernpunkt
des neoliberalen Kapitalismus ist.
Wohin
führt die Krise?
Es
wäre voreilig und überheblich, heute
sagen zu wollen, wohin uns die Krise führt,
aber eine Rückkehr zur Normalität
ist aufgrund der Tragweite unwahrscheinlich.
Eines steht auf alle Fälle fest, nämlich
dass die Grundlagen des US-amerikanischen
Modells durch die Finanzkrise infrage gestellt
werden. Denn dieses beruht auf einem doppelten
Defizit: dem Außenhandelsdefizit und
der negativen Sparquote. In beiden Fällen
spielt das Finanzwesen eine ausschlaggebende
Rolle für das Zustandekommen dieser negativen
Bilanz: Auf dem Binnenmarkt hat sie die wachsende
Verschuldung besonders im Hypothekenbereich
erst ermöglicht, und nach außen
läge es eigentlich an ihr, für eine
ausgewogene Zahlungsbilanz zu sorgen. Sobald
aber der Finanzmarkt einbricht, verschwinden
die Voraussetzungen für diese Wachstumsmodell:
Die Verschuldung der Haushalte ist fortan
blockiert und der Kapitalzufluss von außen
nicht mehr gewährleistet. Dadurch führt
uns die Finanzkrise zu einer dauerhaften Konjunkturschwäche
in den USA, die sich auf den Rest der Welt
übertragen wird.
Ein
Ausweg aus dieser Situation wird nicht einfach
sein. Eine wirkliche Alternative wäre
die Rückkehr zu einer Art „Fordismus”
mit einem Anstieg der Löhne entlang des
Produktivitätswachstums, einer weniger
ungleichen Einkommensverteilung und der Wiederherstellung
einer ausgewogenen Außenhandelsbilanz.
Ein solches Modell ist theoretisch denkbar,
setzt aber in der Praxis eine drastische Umkehr
der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse
voraus, was momentan illusionär scheint.
Der absehbare Wahlsieg von Obama wird kaum
dazu führen, dass ein Wirtschaftsprogramm
wie weiland unter Roosevelt erfolgen wird.
Dafür fehlen ihm der politische Wille
und auch die Mittel, da das Rettungspaket
für die Banken den Haushalt langfristig
belasten wird.
Die
weitere Entwicklung der US-Wirtschaft wird
weltweite Auswirkungen haben. Eine wesentliche
Stellschraube ist dabei der Dollarkurs, der
weiter fallen dürfte, weil die USA dadurch
ihren Export anschieben und ihr Handelsdefizit
abbauen können. Außerdem würde
sich die Staatsverschuldung dadurch faktisch
verringern. Zugleich dürfte damit die
Rezession auf ganz Europa übergreifen,
da dies eine empfindliche Aufwertung des Euro
zur Folge haben wird. Eine Abwertung des Dollars
oder auch der Verbleib auf gegenwärtigem
Niveau wirft auch die Frage auf, ob der Kapitalzufluss
in die USA weiterhin bestehen bleibt. Irgendwann
werden die Schwellenländer und die Ölexportnationen
abgeschreckt werden, weil die Renditen nicht
ausreichen und die Risiken zu hoch erscheinen.
Andererseits haben sie wenig Interesse an
einem schwachen Dollar, weil dadurch die von
ihnen in den USA getätigten Anlagen entwertet
werden.
Auch
ein weiterer Faktor muss in Rechnung gestellt
werden: Wenn die US-Wirtschaft dauerhaft schwächelt,
geht den Schwellenländer ein wichtiger
Absatzmarkt verloren und sie werden gezwungen
sein, die Nachfrage auf dem Binnenmarkt anzukurbeln.
Auch wenn es nicht einfach ist, diese Faktoren,
die sich unterschiedlich schnell entwickeln,
zu gewichten, sind zwei Prognosen dennoch
möglich:
-
Die Zeit um die Krise zu überwinden
wird abhängig sein vom Umfang der Geldmengen,
die für die Rettung des Finanzsektors
aufgewendet werden. Am wahrscheinlichsten
ist ein Szenario wie damals in Japan, wonach
es mehrere Jahre dauern wird, um die Summen
aufzubringen, die jetzt verschlungen werden,
die weit jenseits der Dimensionen der früheren
Finanzkrisen liegen. Wenn keine alternativen
Maßnahmen erzwungen werden, wird sich
der Kapitalismus – wenigstens in den
Metropolen – auf ein geringeres Wachstum
und soziale Einschnitte einstellen müssen.
Die wirtschaftliche Rezession ist bereits
angekommen und die maßgeblichen Sektoren,
wie die Automobilindustrie, stecken schon
mitten in der Krise.
-
Die Bewältigung der Krise wird einhergehen
mit heftigen Auseinandersetzungen zwischen
den Hauptakteuren der Wirtschaft, die die
Auswirkungen möglichst auf die anderen
abwälzen wollen. Sozialpolitisch bedeutet
dies, dass das Kapital verschärften
Druck auf Löhne und Sozialausgaben
ausüben wird. Auf internationaler Ebene
wird sich der Handels- und Wirtschaftskrieg
zwischen den Metropolen weiter zuspitzen
und tendenziell zu einer Aufspaltung der
Weltwirtschaft führen, zumal „die
USA ihre Position als Supermacht auf dem
Weltfinanzmarkt verlieren werden”,
wie es der deutsche Finanzminister ausdrückt.
Die
europäischen Dogmen auf dem Prüfstand
Die
Konkurrenz lebt auch unter der Krise fort.
Die Missklänge in den Erklärungen
und Entscheidungen auf Regierungsebene spiegeln
dieses Dilemma zum Teil wider: Einerseits
herrscht Einverständnis, dass die Krise
nach globalen Lösungen verlangt, andererseits
versucht jeder, seinen Vorteil zu wahren und
möglichst sauber raus zu kommen. Dies
trifft natürlich für das Einzelkapital
zu, wie die Diskussion über die Modalitäten
des Paulson-Plans gezeigt hat, nämlich
ob alle Finanzinstitute gerettet werden sollen
oder nur die „lahmen Enten”. Umso
mehr gilt dies für das politische Einvernehmen
weltweit, wo allerorten das Wiederaufleben
der Nationalinteressen zu spüren ist.
Das
über den gesamten Weltmarkt verstreute
Kapital drängt zurück in den heimischen
Hafen und unter das Schutzschild des Nationalstaats.
Trotzdem lässt sich nicht von einer „Renaissance
des Nationalstaates” reden, da dieser
letztlich immer der Garant für die Interessen
der Bourgeoisie ist. Hier zeigen sich auch
wieder einmal die Grenzen der Theorie des
Empire: Die Globalisierung hat weder zur Aufhebung
der kapitalistischen Konkurrenz und der Rivalität
unter den Kapitalisten noch zur Bildung einer
kapitalistischen Weltregierung geführt.
In Europa lassen sich die Abstimmungsprobleme
dadurch erklären, dass die Länder
unterschiedlich stark von der Krise betroffen
sind. Darin zeigt sich auch, dass es kein
gesamteuropäisches Kapital im eigentlichen
Sinne gibt. Solange es darum ging, Liquidität
in das System zu pumpen, konnte die EZB intervenieren,
wenn auch immer nur von Fall zu Fall. Sobald
aber die Ausgaben von den Einzelhaushalten
der Staaten getroffen werden mussten, zeigte
sich, dass die EU aufgrund ihrer Verfassung
nicht die Mittel hat, eine solche Krise zu
meistern. Es gibt tiefe Diskrepanzen zwischen
Frankreich, das einen Rettungsplan auf europäischer
Ebene favorisiert, und Deutschland oder Irland,
die jeder für sich sprechen. Diese Differenzen
werden zweifellos vorübergehend überbrückt
werden, wenn sich die Krise weiter ausdehnt.
Dennoch wird es so sein, dass die Krise die
eigentlichen Grundlagen für die Schaffung
eines neoliberalen Europa dauerhaft infrage
gestellt haben wird. Außerdem wird sie
die strukturelle Schwäche der europäischen
Wirtschaft hervortreten lassen: „Pessimismus
macht sich breit” – selbst auf
mittlere Sicht.
Die
Auswirkungen auf die Arbeiterklasse
Im
Moment ist die allgemeine Reaktion so, als
ob die Krise eine Art Naturkatastrophe wäre,
die alle in gleicher Weise betrifft. Der französische
Premierminister Fillon appellierte natürlich
auch sofort an die nationale Einheit. In dieser
allgemeinen Panikstimmung soll sich jeder
wie ein Spekulant vorkommen. Die Bankenzusammenbrüche
werden so dargestellt, als bedrohten sie in
gleicher Weise die KleinanlegerInnen. Zwar
steckt dahinter kein Komplott, aber es trägt
doch dazu bei, die sozialen Weiterungen mit
der Kernfrage: „Wer soll den Schaden
bezahlen?” zu verschleiern.
In
den Augen der Besitzenden sind zuvorderst
die ArbeiterInnen von jetzt an gefordert –
nicht so sehr als SparerInnen, sondern als
Lohnabhängige oder RentnerInnen. Die
Krise hat schon Millionen Haushalte in den
USA ruiniert, aber die schwerwiegendsten Konsequenzen
stehen noch aus, v. a. für die RentnerInnen
jener Länder, in denen Pensionsfonds
am weitesten verbreitet sind: USA und Großbritannien.
In diesen beiden Ländern stand das Rentensystem
bereits kurz vor dem Bankrott, und die Rentenbezüge
werden durch den Börsencrash massiv sinken.
Dies macht deutlich, dass es definitiv schwachsinnig
ist, mit seiner Rente an der Börse zu
spekulieren. Eigentlich sollten die Rettungspakete
diesen Aspekt berücksichtigen, was der
Paulson-Plan aber natürlich nicht tut.
Die
Lohnabhängigen sind doppelt unter Beschuss:
zum einen direkt, weil die Unternehmer ihre
finanziellen Verluste durch noch striktere
Lohnstopps ausgleichen wollen, wobei ihnen
die drohende Inflation oder der Erdölpreis
als Argument gereichen und sie die allgemeine
Verunsicherung ausnutzen. Zum anderen gibt
es die indirekten Auswirkungen der Finanzkrise
auf die Realwirtschaft, die in erheblichem
Umfang Pleiten und Entlassungen nach sich
ziehen werden. Die Vernichtung von Arbeitsplätzen
hat in den USA oder Frankreich bereits begonnen.
Außerdem werden die ArbeiterInnen als
erste von den Kürzungen der Sozialausgaben
betroffen sein, mit denen die Rettungspakete
gegenfinanziert werden sollen.
Abschaffung
der Finanzindustrie und soziale Sicherung
Die
Krise bestätigt in eklatanter Weise die
Kritik am Finanzkapitalismus aus Sicht der
AntikapitalistInnen und/oder der GlobalisierungsgegnerInnen.
Alle Wirtschaftsanalytiker, die die Segnungen
der Finanzwirtschaft gepriesen haben, rufen
inzwischen laut nach Regulierungsmaßnahmen.
In Frankreich kann Sarkozy gar nicht harte
Worte genug finden, um die Exzesse des Kapitalismus
anzuprangern, während er sich zuvor noch
den Ausbau der Hypothekenkredite auf die Fahnen
geschrieben hatte. Die ideologische Landschaft
ändert sich rasant und die Konfusion
unter den neoliberalen Aposteln muss genutzt
werden.
Trotzdem
bedeutet dies nicht automatisch, dass durch
die Krise alternative Lösungen begünstigt
würden. Die neoliberalen Konvertiten
salbadern nur und legen immer wieder neue
Rettungsvorschläge auf Basis des bestehenden
Systems auf: mehr Transparenz, bessere Bankenaufsicht,
Trennung von Geschäfts- und Investmentbanking,
Ausweitung der Bilanzpflicht auf die verbrieften
Schuldtitel, Begrenzung der Managergehälter,
Rating, Reform des Aufsichtswesens etc.
Es
geht darum, „den Kapitalismus vor den
Kapitalisten zu retten” [2], wie ein
Analytiker meinte. Die o. g. Vorschläge
graben der sozialliberalen Linken das Wasser
ab, da es ihrem Programm entnommen zu sein
scheint. Eigentlich ist es das absolute Minimum
und lenkt im Grunde von den wahren Erfordernissen
ab. Sicherlich sind einige der Forderungen
unterstützenswert, wie etwa das Verbot
von Steuerparadiesen, aber es wäre naiv,
ausgerechnet den Finanzaufsichtsbehörden
oder den Regierungen die Umsetzung zu überlassen.
Vielmehr müssen diese Maßnahmen
in einen umfassenderen Forderungskatalog eingebunden
werden, der an die Wurzeln des Finanzkapitalismus
reicht und die sozialen Probleme in den Vordergrund
rückt. Denn letztendlich – um es
noch einmal zu sagen – beruht der Finanzkapitalismus
auf der bewussten Vernachlässigung der
sozialen Bedürfnisse der Bevölkerungsmehrheit.
Insofern kann man die Finanzblase nicht ein
für alle Mal zum Platzen bringen, ohne
den Hahn abzudrehen, aus dem sie sich speist.
Diese
Orientierung mag von Land zu Land variieren.
Für Europa wären zwei Kernpunkte
relevant. Zunächst die Verstaatlichung
der Banken. Auf den Einwand hin, dass genau
dies doch im Moment geschieht, ließe
sich antworten, dass damit ja bewiesen wäre,
dass es möglich ist. Aber was im Moment
passiert, läuft auf eine Sozialisierung
der Verluste hinaus und dient nur der Rettung
des privaten Bankenwesens. Eine wirkliche
Verstaatlichung oder besser Vergesellschaftung
muss entschädigungslos erfolgen und auf
das gesamte Finanzwesen abzielen, da es als
ganzes auch für die Krise verantwortlich
ist, egal ob selbst betroffen oder nicht.
Andernfalls liefe dies nur auf eine staatliche
Unterstützung zur Umstrukturierung des
Bankensektors hinaus.
Der
zweite Punkt wäre die soziale Sicherung,
damit die staatlichen Beihilfen nicht wieder
auf eine steuerliche Bevorzugung der Reichen
hinauslaufen. Vielmehr müssen die Lohnabhängigen
vor den Folgen der Krise geschützt werden,
da ihnen dafür in keinem Fall auch nur
der Funken von Verantwortung angelastet werden
kann. Gleichzeitig müssen Maßnahmen
propagiert werden, die auf eine andere Verteilung
der Einkünfte hinauslaufen und argumentativ
dem Bestreben nach sozialer Gerechtigkeit
entsprechen. Es muss verhindert werden, dass
die Unternehmen weiterhin riesige Dividenden
an ihre Aktionäre ausschütten und
zugleich Leute entlassen oder Stellen abbauen
und die Löhne blockieren. Zur Verdeutlichung
sei als Beispiel Frankreich genannt, wo die
Nettodividenden 12,4 % der gesamten Lohnsumme
entsprechen (2007), während 1982 das
Verhältnis noch bei 4,4 % lag.
Die
Krise bietet somit die Gelegenheit, dieses
Missverhältnis wieder zu beseitigen.
Statt die Löhne einzufrieren, müssen
jetzt die Dividenden eingefroren und in einen
Ausgleichsfonds gesteckt werden, der unter
der Kontrolle der Beschäftigten steht
und der anderweitigen Verwendung dient. Beispielsweise
könnten diese Summen darauf verwandt
werden, den Entlassenen ihr bisheriges Einkommen
zu sichern (das Verbot von Dividenden würde
also das Verbot von Entlassungen finanzieren)
und die Sozialversicherung, den Sozialhaushalt
und die öffentlichen Ausgaben zu finanzieren.
Über die Aufteilung muss demokratisch
entschieden werden. Eine weitere Maßnahme
wäre die Sicherung der Kaufkraft der
Lohnabhängigen, indem den Unternehmen,
die sich verweigern, die öffentlichen
Beihilfen entsprechend gekürzt werden.
Nur mit solchen Maßnahmen ließe
sich erreichen, dass diejenigen bezahlen,
die die Krise zu verantworten haben, und zugleich
wäre eine Basis für eine bessere
Verteilung der Reichtümer geschaffen.
Die Summen, um die es dabei geht, liegen bei
90 Milliarden Euro – entsprechend 5
% des französischen BIP, was exakt dem
Verhältnis der 700 Milliarden Dollar
des Paulson-Pakets zum US-amerikanischen BIP
entspricht.
[1]
Detaillierte Berichte sind zu finden bei Les
Échos „La crise financière
mondiale au jour le jour”, http:/tinyurl.com/toxico2
oder Jacques Sapir „Sept jours qui ébranlèrent
le monde” http://tinyurl.com/toxico1
[2]
Luigi Zingales „Why Paulson is Wrong”,
September 2008; http://gesd.free.fr/zingales.pdf
Michel
Husson ist Wirtschaftswissenschaftler am Institut
de recherches économiques et sociales
(Paris) und beschäftigt sich hauptsächlich
mit der herrschenden Beschäftigungspolitik.
Er ist Mitglied der Stiftung Copernic und
des Wissenschaftlichen Beirats von Attac.
Seine Bücher sind zum Teil auch auf Deutsch
erschienen. Näheres zu seinen Publikationen
unter http://hussonet.fr
Übersetzung:
MiWe
|
|
|